Die Geschichte von Sindbad dem Seefahrer und Sindbad dem Lastträger
In der Zeit des Herrschers Harun al Raschid lebte in Bagdad ein Mann namens Sindbad. Er war ein armer Mann und musste sich als Lastträger sein Geld verdienen. Die Arbeit war schwer, und sehr oft träumte Sindbad davon, reich zu sein und ruhig leben zu können.

Eines Tages, als er wieder einmal eine schwere Last zu tragen hatte und die sengende Sonne erbarmungslos auf ihn hernieder brannte, überkam ihn eine große Müdigkeit. So blieb er stehen, wischte sich den Schweiß von der Stirn und seufzte.
Da sah er, dass er sich vor der Tür eines großen weißen Hauses befand. Vor dieser Pforte stand eine breite Ruhebank. Als Sindbad sie sah, beschloss er, seine Last abzulegen und sich einen Moment auf dieser Bank in Ruhe zu verschnaufen. Er setzte sich seufzend. Dann spürte er, wie aus der Pforte der Duft von Rosen wehte.
Sindband lauschte und hörte nun, wie verschiedene Melodien von Saiteninstrumenten erklangen. Nun hörte er das Gezwitscher von Vögeln. Sindbad liebte Tiere sehr und er unterschied den Gesang der Nachtigall, das Gurren der Turteltaube und den Ruf der Drossel. Und er hörte noch andere Vogelstimmen, die er nicht kannte. So schritt er neugierig näher.
Als er durch das Gitter im Tor blickte, sah er in einen herrlichen Garten. Es gab ungewöhnliche schöne Blumen und Bäume hier. In der Mitte des Gartens befand sich ein Teich, der war voll mit goldenen und silbernen Fischen.
Auch andere Tiere gab es in schönen Käfigen. Die bunten Vögel, die in den Zweigen saßen, sangen ihre Lieder, und auf den breiten Kieswegen schlugen die Pfauen ein Rad. Zwischen all den Tieren und Pflanzen liefen Sklavinnen und Diener herum. Sie lachten und es sah aus, als feierten sie ein Fest.
Als Sindbad das sah, wurde er sehr unglücklich. Oh Allah!, rief er. Warum ist das so? Warum feiern die einen ein Fest und leben im Überfluss, und die anderen arbeiten und leiden und leben im Elend, wie ich. Und dann fiel ihm ein Vers ein:
Wenn ich erwache, wartet die Arbeit auf mich.
Und mein Los ist Last.
Wenn der Reiche erwacht, ist alles geschafft.
Und sein Los ist der Spaß.
Die Reichen feiern Feste, die Armen müssen fasten.
Die einen ruhn sich aus, die andern tragen Lasten.
Diese Reime murmelte er immer wieder, und dann fand er eine Melodie dazu und sang sie vor sich hin. Dabei ging er ganz gedankenverloren immer weiter und stand plötzlich am Tor. Da öffnete ein Sklave plötzlich die Pforte und bat ihn, einzutreten. Der Herr des Hauses, so sagte er, wünsche ihn zu sprechen.
Sindbad winkte ab und sagte, das müsse ein Irrtum sein, doch der Sklave bat ihn, ihm zu folgen. Da ging er hinter ihm her. Es erschien ihm alles wie ein Traum. Er durchquerte den Garten, stieg dann die Treppe hinauf und ging durch eine Vorhalle. Schließlich gelangte er in einen festlichen Saal.
Der Saal war mit Blumen geschmückt. In kostbaren Schalen aus glitzerndem Kristall lagen die seltensten Früchte. Kostbare Speisen standen auf dem Tisch. In dieser erlesenen Gesellschaft, die sich hier befand, gab es junge Sklavinnen, die tanzten und musizierten.
Auf einem Platz, der etwas erhöht war, saß ein älterer Mann. Sein Gesicht war voller Falten, seine Haare waren weiß. Würdevoll blickte er auf die Gesellschaft hinunter, dabei lächelte er freundlich.

Sindbad war verwirrt. Bei Allah, sagte er sich. Entweder bin ich hier im Palast des Königs, oder ich bin im Paradies. Er grüßte höflich in die Menschenmenge und senkte dann den Kopf, um auf weitere Anweisungen zu warten.
Der Herr des Hauses winkte ihn zu sich und bat ihn, sich zu ihm zu setzen. Dann ließ er ihm ausgesuchte Speisen bringen. Gelobt sei Allah, sprach Sindbad. Dann nahm er die Speisen und aß sich satt. Danach wusch er sich die Hände, verbeugte sich und dankte für die Bewirtung.
Da sprach der ältere Mann zu ihm: Sei willkommen und dein Tag sein gesegnet. Sage mir, wie du heißt und wer du bist. Mein Name ist Sindbad und ich bin Lastträger von Beruf, entgegnete Sindbad.
So bist du mir wie ein Bruder, denn auch mein Name ist Sindbad. Allerdings nennt man mich Sindbad den Seefahrer, erwiderte der Herr. Immer wenn ich Menschen vor meinem Garten stehen sehe, die ihn bewundern, bitte ich sie, herein zu treten und mein Gast zu sein. Besonders gerne tue ich das, wenn ich sehe, dass den Menschen nicht so viel Glück im Leben geschenkt wurde.
Denn wer in seinem Leben das Glück hat, im Überfluss zu leben, der teile es mit seinen weniger glücklichen Brüdern. Glück zu haben ist eine Gnade und ein Geschenk Allahs, das wir uns immer wieder neu verdienen müssen.
Auch wir müssen wissen, dass uns Allah alles wieder über Nacht nehmen kann, und dass es schon Morgen sein kann, dass wir an anderen Gärten stehen und uns freuen, wenn uns jemand herein bittet.
Dies aber ist ein besonderer Tag, denn weil du den gleichen Namen wie ich trägst, sollen wir besonders daran erinnert werden, dass wir Brüder sind, der eine aber darf sich ausruhen, der andere aber muss die Lasten tragen.
Sindbad wurde etwas verlegen, und ihm fiel der Vers wieder ein, den er gesungen hatte. Der Herr schien seine Gedanken erraten zu haben. Man hat mir berichtet, du habest ein kleines Lied vor der Tür gesungen, sagte er. Ich möchte dich herzlich bitten, es hier noch einmal zu singen.
Da entschuldigte sich Sindbad für sein Lied, doch der Herr rief: Du musst dich nicht entschuldigen, mein Bruder. Du hast doch Recht mit deinem Vers. Er spricht die Wahrheit. Die Reichen müssen an die Armen erinnert werden, damit sie ihnen helfen, ihre Not zu lindern.
Ich sage dir etwas, mein Freund. Wenn du diesen Vers vorträgst, werde ich dir im Gegenzug meine Geschichte erzählen. Dann wirst du erfahren, woher mein Reichtum stammt, und anschließend wirst du sehen, dass ich Mühen und Leiden erleiden musste, bevor ich diesen Wohlstand erreichte.
Ich habe Gefahren erlebt und gefährliche Irrfahrten musste ich überstehen. Sieben Reisen über das Meer machte ich, und an jeder hängt eine Geschichte. In all diesen Zeiten meinte es das Schicksal nicht gerade gut mit mir, weniger noch, als es dir beschieden ist.
Aber glaube fest daran, der Lauf unseres Lebens kann sich ändern, ohne dass wir es ahnen, und dass uns Gutes und Böses widerfahren kann.
Du sprichst weise und gütig mit mir, sagte der Lastträger. Ich möchte zu gerne deine Geschichte erfahren. Und Sindbad der Seefahrer erzählte Sindbad dem Lastträger die Geschichte seiner ersten Reise.
Die erste Reise Sindbad des Seefahrers
Mein Vater, ein reicher Kaufmann, starb, als ich noch klein war. Er hinterließ mir Geld und Gut, und so lebte ich im Wohlstand. Ich aß das beste Essen, ich trank nach Herzenslust und ich trug die schönsten Gewänder.
Ich hatte viele Freunde um mich herum und genoss das Leben in vollen Zügen. Nie hatte ich einen Gedanken an die Zukunft, ich dachte, das Leben würde immer so weiter gehen. So gab ich das Geld mit vollen Händen aus und lebte nur zu meinem eigenen Vergnügen, bis ich eines Tages wie aus einem Rausch erwachte.
Da stellte ich fest, dass ich all mein Geld ausgegeben hatte und mein Leben schal und langweilig geworden war. Aus meiner sorglosen Selbstzufriedenheit waren Unzufriedenheit, Zweifel und Angst geworden.
Ich dachte nach und mir fiel ein alter Spruch von Salomo, dem Sohn Davids wieder ein, den mein Vater oft gesagt hatte: Es gibt drei Dinge, die besser sind als drei andere Dinge: Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt, Mut ist besser als Klagen und das Grab ist besser als die Schwäche. So wage es, dein Leben zu leben und fürchte dich nicht!
Da verkaufte ich mein ganzes Vermögen, auch meine schönen Kleider, und beschloss, in ferne Länder zu reisen. Ich beschaffte mir alles, was ich für die Reise brauchte und stach mit einer Gesellschaft unternehmenslustiger Kaufleute in See.
Unser Schiff reiste über Bassora bis ins weite Meer hinein. Tag und Nacht segelten wir, vorbei an geheimnisvollen Inseln und bildschönen Küsten. Wo immer wir anhielten, handelten und tauschten wir unsere Waren. Zuerst verdienten wir nicht viel, später dann aber immer mehr. Unsere Waren auf dem Schiff wurden immer mehr. Ein großer Platz mir Waren im Laderaum gehörte mir.
Dann kamen wir an eine Insel, die noch niemand vorher gesehen hatte. Sie sah zunächst aus wie eine Sandbank, doch es wuchsen Gras und Sträucher darauf. Hier warfen wir den Anker und gingen an Land. Einige gingen umher und sahen sich um, andere machten Feuer und kochten, andere badeten. Kurzum, jeder machte das, was ihm gut tat.
Auch ich gehörte zu den Menschen, die ein bisschen über die Insel schlenderten. Plötzlich tönte die Stimme des Kapitäns vom Schiff zu uns herunter. Er schrie, so laut er konnte, und seine Stimme hörte sich schrill und verzweifelt an:
Heeda, Leute, lauft so schnell ihr könnt zum Schiff zurück! Rettet euch, wenn euch euer Leben lieb ist. Rettet euch auf das Schiff. Die Insel, auf der ihr seid, ist keine Insel, sie ist ein riesiger Fisch. Eure Füße stehen auf dem Rücken eines Fisches.
So ein Unsinn, sagten einige. Das kann doch gar nicht sein! Hier ist doch Erde und das da vorne sind Sträucher. Ihr täuscht euch!, schrie der Kapitän. Der Fisch ist so groß, dass sich Sand auf ihm abgelagert hat. Darauf haben sich sogar Pflanzen gebildet. Jetzt aber habt ihr ein Feuer angemacht, und der Fisch hat die Hitze gespürt. Er hat sich schon bewegt, und jeden Moment kann er in die Tiefe abtauchen.
Da ließen alle ihre Sachen am Strand zurück, Kessel, Töpfe, Vorräte und Kleider, und rannten zum Schiff. Einige erreichten es mit knapper Müh und Not, andere schafften es nicht. Zu denen, die es nicht mehr schafften, gehörte leider auch ich. Ich war einfach nicht schnell genug.
Die Insel erzitterte und versank mit allem, was auf ihr war, in die Tiefe des Ozeans. Ich ging mit allen, die es nicht geschafft hatten, unter wie ein Stein. Die Wellen schlugen über mir zusammen und ich schlug um mich und kämpfte um mein Leben.
Doch Allah, der Allmächtige bewahrte mich vor dem Ertrinken. Er ließ ein großes Fass vor mir auftauchen. Ich klammerte mich daran, zog mich dann dort hinauf und ritt wie auf einem Pferd auf den hohen Wellen. Dabei benutzte ich meine Beine und Füße wie ein Ruder.
Noch eine Weile konnte ich das Schiff sehen, das sich immer weiter von mir entfernte, bis es schließlich hinter dem Horizont verschwand. Dann machte ich mich auf meinen Tod gefasst. Die Dunkelheit kam. Ich wurde von den Wellen weiter und weiter geworfen, bis ich plötzlich mit samt dem Fass auf eine Insel geschleudert wurde.
Schwach von der langen Reise und zitternd vor Angst klammerte ich mich an einem Ast fest und zog mich an Land. Ich fühlte mich taub und starr von der Verkrampfung und spürte unter meinen Füßen einige Verletzungen, die von Bissen der Fische stammten.

Erschöpft ließ ich mich in den Sand fallen und schlief ein. Mein Schlaf glich einer Ohnmacht, aus der ich erst wieder erwachte, als die Sonne hoch am Himmel stand. Noch liegend sah ich mich um. Es war eine schöne, grüne Insel, auf die ich geraten war. Dicke wunderschöne Bäume neigten sich über den Strand.
Meine Füße fühlten sich dick und geschwollen an, und ich war nicht in der Lage, zu laufen. So musste ich wie ein Tier auf den Knien kriechen. Es entsprangen klare Quellen auf der Insel, und es gab leckere Früchte, auf die ich gierig zu kroch.
Ich aß von den Früchten und trank von dem Wasser, bis ich wieder zu Kräften gekommen war. Irgendwann konnte ich auch wieder aufrecht gehen, wenn ich auch noch mühsam hinkte. Ich machte mich auf, die Insel zu erkunden. Es war eine schöne Insel, und ich freute mich an allem und dankte Allah dafür.
Als ich ein paar Tage später erneut hinkend und mit meinem Stab in der Hand die Insel erkundete, sah ich in der Ferne etwas, das wie ein wildes Tier aussah. Ich ging vorsichtig näher, doch da erkannte ich, dass es eine edle Stute war, die dort stand.
Sie war am Ufer des Meeres festgebunden. Als die Stute mich sah, stieß sie einen Furcht erregenden Schrei aus. Ich bekam es mit der Angst zu tun und flüchtete. Doch da kam ein Mann vor irgendwo hervor und rannte hinter mir her. Wer bist du, woher kommst du und was machst du an diesem Ort?, rief er.
Da blieb ich stehen und drehte mich um. Ach, ich bin in großer Not, entgegnete ich. Ich wurde in das Meer gespült und entging nur knapp dem Tode. Allah schickte mir in seiner unendlichen Gnade ein Fass, damit rettete ich mich auf diese Insel.
Als der Mann das hörte sprach er: Komm mit mir! und führte mich in eine unterirdische Wohnung, die so groß wie ein Haus war. Dann bat er mich, mich nieder zu setzen und brachte mir Essen herbei. Hungrig wie ich war aß ich davon, bis ich nicht mehr konnte.
Der Mann sah mir dabei zu und freute sich, dass ich so einen Hunger hatte. Dann musste ich alles erzählen, was ich erlebt hatte. Nun musst du auch erzählen, wer du bist und warum du hier unter der Erde wohnst, wollte ich wissen. Und warum hast du diese wunderschöne Stute am Strand angebunden?
Da antwortete er: Ich bin ein Pferdeknecht des Königs Mihrdaschan. Ich hüte alle Pferde des Königs. Wenn Neumond ist, binden wir die Stuten am Meer an, denn um Mitternacht steigen die schönsten Hengste aus dem Meer.
Sie paaren sich mit den schönen Stuten, wenn sie niemand sieht, und dann ein paar Monate später bekommen sie wunderschöne Fohlen. Sie sind so unglaublich hübsch, wie du sie auf der ganzen Welt nicht gesehen hast.
Ich war verwundert über diese Geschichte. Komm mit mir, sagte der Pferdewirt dann. Ich bringe dich zum König. Danach zeige ich dir unser Land. Du hast Glück, wir sind hilfsbereite Menschen, wir werden dir helfen, damit du in deine Heimat zurückkommen kannst.
Ich dankte ihm, und wir saßen noch eine Weile zusammen. Viele andere Pferdewirte kamen dazu, und ich musste meine Geschichte immer wieder erzählen. Dann gaben sie mir eine Stute zum Reiten, und wir ritten landeinwärts, bis wir zur Hauptstadt des Königs Mihrdschan kamen.
Meine Begleiter gingen zum König und erzählten ihm von mir. Er wünschte, mich zu sehen, begrüßte mich herzlich und wünschte mir ein langes Leben. Dann ließ er mich ebenfalls meine Geschichte erzählen. Meine Geschichte gefiel ihm, und er ernannte mich danach zum Wächter über den Hafen und über alle Schiffe, die in dem Hafen einliefen.
Ich brachte es in der Tat zu großem Ansehen. Das Volk hatte Vertrauen zu mir und ich wurde schnell als Vermittler zwischen dem Volk und dem König eingesetzt. So verbrachte ich eine schöne Zeit.
Doch immer wieder dachte ich auch an meine Heimat. Und so oft wenn Seeleute im Hafen einliefen, fragte ich sie nach Bagdad, doch es gab niemanden, der diese Stadt kannte. Das machte mich wirklich unglücklich, denn man wünscht sich nach einem langen Aufenthalt in der Fremde, nach Hause zurück zu kehren.
Aber ich lernte hier in der Fremde auch viel Neues und Sonderbares kennen. Besonders in Erinnerung ist mir die Begegnung mit Indern, die mir von ihrem Land erzählten. Es gibt in Indien, wenn sie mir wirklich die Wahrheit erzählten, verschiedene Kastenwesen, insgesamt wohl zweiundsiebzig. Diese Kasten sind streng voneinander getrennt.
Die vornehmste Kaste nennt sich Schakirijah, und wer ihr angehört, darf niemandem etwas zu Leide tun. Er darf auch nicht zulassen, dass anderen Menschen ein Unrecht geschieht. Diese Kaste kann man wirklich nur loben.
Eine andere Kaste sind die Brahmanen. Sie dürfen keinen Wein trinken. Trotzdem ist es ihnen möglich, fröhlich und heiter, dazu noch weise zu sein. Von den anderen Kasten verstand ich nur wenig. Ich wunderte mich aber ein wenig, dass ein Volk mit diesem Kastendenken so viele kluge und gelehrte Weise und Seher hervor gebracht hat.
Ich sah am Hafen aber nicht nur seltsame Menschen, ich sah auch ungewöhnliche Tiere. Da war zum Beispiel ein riesiger Fisch, fast zweihundert Ellen lang. Vor dem fürchteten die Menschen sich alle. Sie schlugen Holzstücke aneinander, und weil er diesen Krach nicht ertragen konnte, flüchtete er.
Ich sah auch einen Fisch, der ein Schwert am Kopf trug. Auch ungewöhnliche Vögel konnte ich sehen. Ich sah Vögel, die so klein wie Käfer waren, oder andere, die in bunten Farben leuchteten. Es gab so viele seltsame Sachen, dass ich gar nicht alles aufzählen kann. Mit der Zeit hatte ich diese Insel wirklich gut erforscht. Nur die Meereshengste hatte ich nie zu Gesicht bekommen.
Eines Tages stand ich wieder am Hafen, den Stab in der Hand und schaute auf das Meer hinaus, als ein großes Segelboot auf mich zukam. Es rollte die Segel ein, legte an und warf den Landungssteg aus.
Die Mannschaft begann, die Ladung abzuladen. Ich stand am Schiff und schrieb alles gewissenhaft auf. Eine Ware nach der anderen wurde an Land gebracht, und es schien mir wirklich, als wäre dieses Schiff unerschöpflich.
Freundlich fragte ich den Kapitän: Ist denn immer noch Ware in deinem Schiff? Es scheint ja unerschöpflich zu sein? Oh ja, entgegnete der Kapitän. Es sind noch Waren im Schiffsraum. Sie gehören einem Kaufmann, der ertrunken ist. Seine Waren aber bleiben uns anvertraut, und wir wollen sie nun verkaufen, und den Preis, den wir dafür erzielen an seine Angehörigen in Bagdad weiter geben.
Da wurde ich hellhörig. Wie war der Name des ertrunkenen Kaufmannes?, wollte ich wissen. Er hieß Sindbad, erwiderte der Kapitän.
Jetzt betrachtete ich den Kapitän aufmerksamer, und ich erkannte ihn wieder. Oh Kapitän!, rief ich. Erkennst du mich nicht? Ich bin Sindbad, der mit euch gefahren ist. Erinnerst du dich, als sich dieser Fisch bewegte und uns alle in die Tiefe riss? Ich ging unter, aber dann fand ich ein Fass und rettete mich auf diese Insel.
Hier bin ich nun Hafenmeister. Der freundliche König Mihrdschan machte mich dazu. Diese Waren in deinem Schiff gehören mir. Ich bin so froh, dich getroffen zu haben, denn ich habe so eine Sehnsucht nach der Stadt Bagdad.
Da erwiderte der Kapitän: Bei Allah, es gibt immer wieder Menschen, die haben überhaupt keine Würde. Was soll das heißen?, fragte ich beunruhigt. Glaubst du meinen Worten nicht? Natürlich nicht, erwiderte der Kapitän. Oder hältst du mich tatsächlich für so dumm? Ich weiß doch genau, kaum erzählt man jemandem von einer kostbaren Ladung, die einem Verstorbenen gehört, kommen gleich ein paar Schwindler und behaupten, sie hätten ein Recht auf das Erbe.
Nein, darauf falle ich nicht herein. Ich erinnere mich zwar nicht mehr an Sindbad, aber ich weiß ganz sicher, dass er ertrunken ist. Und du solltest dich gefälligst besser um deinen Hafen kümmern als um Menschen, die dich nichts angehen.
Ich war furchtbar wütend und hatte nicht übel Lust, diesem Kapitän meinen Stab über den Kopf zu schlagen. Dann aber riss ich mich zusammen. Der Kapitän des Schiffes war immer ein ehrlicher und zuverlässiger Mann gewesen und auch jetzt hatte er nicht vor, sich meine Waren anzueignen, sondern das Geld, was sie brachten meinen Erben auszuzahlen.
Ich sprach freundlich zu ihm, erzählte ihm alles, was sich damals auf dem Schiff zugetragen hatte. Auch die Gespräche zwischen uns, die ja nur er und ich wissen konnten, erzählte ich ihm. Da musste er einsehen, dass ich die Wahrheit sprach.
Er rief den Steuermann zu sich, ein Mann, der ein gutes Gedächtnis hatte, und der erkannte mich wieder. Und nun kamen auch die anderen Kaufleute herbei geeilt, umarmten mich und hörten immer wieder meine Geschichte.
Dann sah ich mir meine Waren an, auf die sie meinen Namen geschrieben hatten. Es fehlte nichts. Wieder und wieder lobte ich den gewissenhaften Kapitän. Dann suchte ich aus meinen Waren die schönsten und kostbarsten Dinge heraus und legte sie dem König Mihradschan zu Füßen.
Der König freute sich und gab mir zu Ehren an seinem Hof ein großes Fest. Dann verkaufte ich meine Waren und kaufte von dem Geld Waren der Insel ein, die die Inselbewohner hergestellt hatten. Dann ging ich noch einmal zum König und dankte ihm für seine Freundlichkeit.
Er war traurig über den Abschied und schenkte mir einen kostbaren Ring zum Abschied. Den trage ich immer noch an meinem Finger.
Dann segelten wir weiter, Tag und Nacht, und Allah begleitete uns. Wir machten einen kurzen Aufenthalt in Bassore, dann aber ging es endlich zurück nach Bagdad, der Stadt meiner Sehnsucht.
Als ich zu Hause war und meine Verdienste für meine Waren durchrechnete, erkannte ich, dass ich ein reicher Mann war. Ich kaufte ein Haus mit einem Garten und lud alle meine Freunde zu mir ein.
Doch anders als früher verlief mein Leben jetzt viel vernünftiger. Ich verprasste mein Geld nicht mehr, dafür aber lebte ich viel glücklicher und dankte Allah für jeden Tag, den er mir schenkte.
Zu der Zeit wusste ich noch nicht, dass die Zeit der Prüfungen für mich noch nicht vorbei war. Ich war zwar weiser geworden, doch nach einiger Zeit überkam mich das Gefühl großer Selbstzufriedenheit. Dabei vergaß ich meine Todesnot auf dem Meer, und die Zeit in der Fremde, den Fisch und die Insel.
Dies ist die Geschichte meiner ersten Reise. Wenn du Morgen noch mehr hören willst, werde ich dir von meiner zweiten Reise erzählen.
Und Sindbad der Seefahrer lud Sindbad den Lastträger zum Abendessen ein. Dann ließ er ihm hunderte von Geldstücken überreichen und sprach zu ihm: Wir danken dir für deine gute Gesellschaft.
Sindbad der Lastträger nahm das Geld dankbar entgegen und kehrte in seine Hütte zurück. Am nächsten Morgen ging er wieder zu dem wunderschönen Garten seines Namensvetters und wurde wieder freundlich empfangen.
Sindbad der Seefahrer wartete, bis sich die Freunde um ihn versammelt hatten. Von draußen waren Vogelstimmen zu hören und die Fische flitzten pfeilschnell durch die Teiche. Sindbad der Seefahrer aber erzählte die Geschichte seiner zweiten Reise.
Die zweite Reise Sindbad des Seefahrers
Zu Hause ging es mir gut. Ich war gesund, hatte viel Geld und war gut angesehen. In meinem schönen Haus gingen meine Freunde ein und aus, und es reihten sich die Tage aneinander, wie Perlen auf einer Schnur. Doch wenn man das eine hat, sehnt man sich nach dem anderen.
Ich jedenfalls bekam immer wieder auch Sehnsucht nach der Ferne. Ich hatte das Gefühl, nicht genug von der Welt gesehen zu haben, und dachte, ich würde etwas versäumen, wenn ich nur noch zu Hause bliebe.
So zog es mich immer wieder zum Meer. Ich nahm meinen Vorrat an Geld und Waren, ging an den Strand und heuerte auf einem Schiff an. Es war ein schönes Segelschiff. Die Mannschaft bestand aus erfahrenen Männern, alles junge Matrosen, die den Ozean liebten.
Mit anderen Kaufleuten zusammen bestieg ich das Schiff. Wir verstauten unsere Waren, dann wurde der Anker gelichtet und wir fuhren davon. Ich freute mich, als mir der Duft von Salz und Meer um die Nase wehte.
Unsere Reise brachte Gewinne. Wir segelten von Hafen zu Hafen, von Insel zu Insel und machten unsere Geschäfte. Wir sahen Länder und Menschen, Meere und Sterne. Die schweren Zeiten der Stürme überstanden wir zusammen und wenn die Sonne schien, standen wir auf dem Deck und sangen unsere Lieder.
Eines Tages kamen wir auf einer Insel an, die wie ein Paradies war. Es gab dort Palmen und Blumen, klares Wasser und zutrauliche Tiere. Die Insel schien unbewohnt zu sein. Wir legten an, gingen an Land und wanderten umher. Die Insel war so schön, dass wir Allah, den Allmächtigen dafür priesen.
Da sah ich einen Vogel, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich folgte ihm und entfernte mich dadurch von den anderen. Der Wind wehte sanft und die Blumen dufteten. Mich überkam eine sanfte Müdigkeit. Ich streckte mich aus und schloss die Augen. Im Nu war ich eingeschlafen.
Als ich erwachte, stand die Sonne schon tief. Ich lief zum Strand und musste zu meinem Entsetzen feststellen, dass das Schiff davon gesegelt war. Man hatte mich nicht mitgenommen. Vielleicht hatte man nach mir gesucht und mich nicht gefunden.
Ich rief laut um Hilfe, doch es schien keine Menschenseele zu geben. Das Gefühl von Verlassenheit überkam mich, und mein Herz wurde schwer. Und dann sprach ich zu mir selbst: Ich habe so etwas schon einmal erlebt. Damals wurde ich durch den Pferdewirt und den freundlichen König gerettet, aber ob es diesmal auch eine Rettung gibt, ist ziemlich unwahrscheinlich.
Ich machte mir Vorwürfe, dass ich nicht zu Hause geblieben war, sondern meinem Wunsch nach Fernweh nachgegeben hatte. Warum hatte ich mein schönes Leben in Bagdad gegen diese Abenteuer eingetauscht? So unbeständig ist der Mensch in seiner Meinung, wenn er Angst hat.
Schließlich kletterte ich auf einen Baum und blickte in die Ferne. Doch ich sah nichts außer Himmel und Wasser. Dann drehte ich mich um und schaute ins Landesinnere. Hier sah ich etwas Weißes leuchten. Ich stieg vom Baum herunter und machte mich auf den Weg zu diesem Weißen.
Es war eine seltsame Kuppel, die in die Luft ragte. Sie war glatt und glitschig, dass man nicht auf sie steigen konnte, sie hatte aber auch kein Tor, damit man in sie hinein gehen konnte. Und so stand ich stumm da, starrte dieses Ding an und überlegte, wie man wohl hinein geraten kann.
In der Zwischenzeit neigte sich der Tag dem Ende zu. Die Sonne versank und es wurde dunkel um mich. Die Luft erschien mir richtig schwarz und schwer. Erschrocken über so eine große Finsternis blickte ich zum Himmel.
Da sah ich, wie ein riesengroßer Vogel hernieder geflogen kam. Seine riesigen schwarzen Flügel verdeckten alles Licht, das es noch am Himmel gab. Da fiel mir eine Geschichte ein, die mir Pilger und Reisende erzählt hatten, und die ich damals nicht glauben wollte.
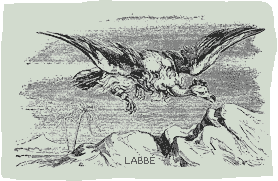
Sie erzählten, dass auf einer Insel ein ungeheuer großer Vogel lebte, der Roch hieß. Dieser Vogel fütterte seine Jungen mit Schlangen. Und nun wurde mir schlagartig klar, dass die Kuppel, die ich entdeckt hatte, das Ei dieses Vogels war.
Der Vogel Roch landete auf dieser Kuppel und begann, zu brüten. Dabei hatte er die ganze Kuppel mit seinen Schwingen bedeckt und die Beine nach hinten gelegt. In dieser Stellung schlief er auf dem Ei ein.
Ich betrachtete ihn voller Angst. Dann aber kam mir eine Idee, wie ich mich retten konnte. Diese Rettung war aber gleichzeitig auch eine große Gefahr. Ich nahm meinen Turban vom Kopf, wickelte ihn auf und legte ihn um meine Hüften. Dann band ich mich an einem Bein des Vogels fest.
Vielleicht bringt er mich in ein bewohntes Land, dachte ich. Und selbst wenn er mich in ein Land trägt, in dem Barbaren wohnen, ist es immer noch besser, als auf dieser einsamen Insel zu bleiben. Mit Menschen weiß ich umzugehen, selbst wenn sie schwierig sind, die Einsamkeit aber wird mich umbringen.
Unruhig erwartete ich den Anbruch des Tages. Dann erwachte die Sonne und stieg vom Meer auf. Der große Vogel breitete seine riesigen Schwingen aus, stieß einen Schrei aus und erhob sich in die Luft. Wie eine winzige Fliege klebte ich am Bein des Vogels und ließ mich mit hinauf in die Luft tragen.
Er flog höher und höher und es schien mir, als flöge er direkt in die rote Sonne hinein. Dann endlich flog er sich wieder der Erde entgegen und ließ sich auf dem Gipfel eines Berges nieder. So schnell ich konnte, band ich mich los. Ich hatte furchtbare Angst vor dem großen Vogel, aber er bemerkte mich nicht.
Ich schleich leise davon. Kaum war ich ein paar Meter von ihm entfernt, sah ich, dass der Vogel mit seinen Klauen im Boden wühlte. Dann zog er eine riesige Schlange hervor. Er nahm sie zwischen seine Krallen. Sie wand sich hin und her, doch sie hatte keine Chance. Der Vogel hielt sie fest und flog mit ihr davon.
Ich stieg auf den Berg und blickte über das weite Tal. Die Sonne schien hell und die Gebirge, die das Tal umschlossen, leuchteten. Ich atmete tief ein und aus, dann machte ich mich an den Abstieg. Das war sehr schwierig und mühsam.Dabei stellte ich fest, dass der Boden aus kostbaren Diamanten bestand.
Im Tal wimmelte es nur so von Schlangen und Reptilien. Ihre Körper waren so groß wie Bäume und mit ihren riesigen Mäulern konnten sie mühelos ein Nilpferd verschlingen. Nachts, wenn es dunkel war, kamen sie aus ihren Höhlen, tagsüber aber waren sie verschwunden.
Ich hatte wahnsinnige Angst vor diesen Ungeheuern und mir war jeder Appetit auf Essen und Trinken vergangen. Unruhig blickte ich mich um und überlegte, wie ich wohl die Nacht verbringen konnte, ohne von diesen Drachen verspeist zu werden.
Schließlich entdeckte ich eine Höhle mit einem niedrigen Eingang. Auf allen Vieren kroch ich hinein, nahm dann einen größeren Stein, der in der Mitte der Höhle lag und verschloss damit den Eingang wieder. Jetzt bin ich in Sicherheit, dachte ich.
Doch gerade wollte ich mich übermüdet von der langen Reise auf einen Platz in der Ecke legen, da sah ich in der Dunkelheit eine große Schlange. Sie brütete ihre Eier aus. Ich überlegte, zu fliehen, doch ich wusste nicht, wohin. Schließlich betete ich zu Allah und bat ihn um Schutz für die Nacht. Dann schlief ich ein.
Als ich erwachte, sah ich gerade, wie sich die Schlange über mich beugte und mich mit ihren leblosen Augen anstarrte. So schnell ich konnte, stürzte ich davon. Übermüdet und hungrig und durstig durchwanderte ich das Tal. Plötzlich sah ich zu meinem großen Entsetzen ein blutiges Tier vom Himmel fallen. Nirgends aber sah ich jemanden, der es so zugerichtet hatte.
Und dann fiel mir etwas ein, das so entsetzlich war, dass ich Mühe hatte, zu atmen. Ich war im Diamantental gelandet, das Tal, in dem Drachen leben. Der Vogel Roch und auch andere Pilger und Reisende hatten mir schon davon erzählt. Niemand, so hatten sie gesagt, kommt lebend aus diesem Tal des Schreckens heraus.
Die Diamantensucher aber hatten einen Trick entwickelt, sich in den Besitz von Edelsteinen zu bringen. Sie schlachteten ein Schaf und warfen den blutigen Kadaver ins Tal. An diesem klebrigen Körper klebten nun Diamanten.
Wenn die Sonne hoch am Himmel stand, kamen die Geier und stürzten sich auf die toten Tiere. Sie rissen sie in Stücke und trugen sie an die Stelle, wo sich ihr Host befand. Dann aber kamen die Diamantensucher herbei, vertrieben die Geier und nahmen die Diamanten an sich. Nur so war es möglich, an die Diamanten heran zu kommen.
Während ich darüber nachdachte, fiel erneut ein totes Schaf neben mich. Ich ging an diese Stelle und sah, dass hier tatsächlich Diamanten wie Kiesel herum lagen. Ich bückte mich, nahm sie und füllte mir damit die Taschen voll.
Dann rollte ich meinen Turban aus, legte mich darauf und bedeckte mich dann mit dem toten Fleisch des Schafes, sodass ich ganz darunter verschwand. Ich ekelte mich natürlich unter dem Fleisch, aber es war die einzige Möglichkeit für mich, in die Freiheit zu gelangen. So band ich mich mit meinem Turban an dem Schaf fest.
Kaum hatte ich das gemacht, schoss ein Geier auf mich nieder und riss das Fleisch, an das ich mich gebunden hatte, mit sich fort. Er trug mich damit auf einen Hügel. Kaum war er dort angekommen, begann er mit seinem spitzen Schnabel auf das Fleisch einzuhacken.
Ich hatte große Angst, dass er mich treffen würde. Doch plötzlich, wie erhofft, ertönte über mir lautes Lärmen und schreiende Stimmen von Menschen. Der Vogel erhob sich, so schnell er konnte und floh.
Ich warf das Fleisch von mir. Mein Körper war über und über mit Blut besudelt. Jetzt sah ich den Mann, der versucht hatte, den Geier zu vertreiben, vor mir stehen, und er sah mich auch. Das war ein furchtbarer Schock für ihn. Doch so erschrocken er auch war, er drehte doch auch das Stück Fleisch hin und her und durchsuchte es nach Edelsteinen.
Oh nein, kein einziges Steinchen ist an meinem Fleisch zu finden, rief er. Stattdessen klebt ein Mann an meinem Hammel. Aber was soll ich mit einem Menschen? Menschen gibt es genug auf der Welt.
Er trat dichter auf mich zu und betrachtete mich angewidert. Du Hammel von Mensch, was soll ich mit dir, rief er. Ich brauche Steine, keine Unholde. Und du bist wahrscheinlich ein Geist oder ein Fleisch fressender Dämon oder ein Räuber, der mich erschlagen wird.
Da wischte ich mir das Blut von Gesicht und sagte: Hab keine Angst, ich bin kein Räuber und kein Geist, ich bin Mensch und sogar Kaufmann, wie du, allerdings nicht so gierig wie du. Aber auch deine Gier kann ich stillen. Ich habe nämlich eine Menge Diamanten bei mir, und wenn du magst, kann ich dir gerne einige davon abgeben.
Obwohl ich dich, das muss ich sagen, sehr unhöflich mir gegenüber erlebt habe. Ich habe das Gefühl, dass du selbst einen Diamanten an der Stelle trägst, wo andere Menschen ihr Herz haben.
Da lachte er und verneigte sich. Entschuldige mein Freund, sagte er. Friede sei mit dir. Gepriesen sei auch Allah. Ich bin kein herzloser Mensch, in bin ein Geschäftsmann. Und dass ich ein bisschen durcheinander bin, darfst du mir nicht verdenken. Es ist schon seltsam, wenn ein Mensch an einem Hammel klebend aus dem Diamantental heraus kommt, das noch nie jemand lebendig verlassen konnte.
Darum verzeih mir mein Freund. Glaub mir, meine Freundschaft und Hilfsbereitschaft sind dir sicher, denn ich bin nicht gierig, sondern ein hilfsbereiter Mensch. Und nun sage mir, wie viele Diamanten du bei dir hast.
Nun kamen auch die anderen Menschen herbei gelaufen. Kaufleute und Diamantenjäger gehörten dazu. Ich musste ihnen von meinem Abenteuer erzählen und sie konnten nicht genug bekommen, mir zuzuhören.
Der Kaufmann aber, mit dessen Hammel ich mich gerettet hatte, bekam einige schöne Diamanten von mir und er war glücklich darüber. Dann zogen wir weiter durch die Täler. Ich sah wunderschöne Kirchen und Basiliken, aber auch Riesenelefanten und Einhörner, Tiere, die eigentlich zur Urzeit gehörten.
Manches Erlebnis hatten wir, manches Abenteuer gab es zu bestehen, doch nichts ist vergleichbar für mich mit dem Abenteuer in dem Diamantental.
Dann endlich erreichten wir Bassora. Ich verabschiedete mich von meinen Reisegefährten und kehrte nach Bagdad zurück, reich an Diamanten und reich an Erlebnissen.
Dies ist die Geschichte meiner zweiten Reise, und wenn Allah will, werde ich dir morgen von meiner dritten Reise erzählen.
Sindbad der Lastträger und alle, die sich um ihn versammelt hatten staunten sehr über diese Geschichten. Dann aßen sie zusammen. Der Hausherr befahl den anderen, Sindbad dem Lastträger hundert Dinare zu geben, wünschte ihm alles Gute und ließ ihn seiner Wege gehen.
Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, sprach Sindbad der Lastträger sein Morgengebet. Dann begab er sich erneut zum Haus von Sindbad dem Seefahrer. Der Herr hieß ihn willkommen und sie frühstückten zusammen. Als auch die anderen Gäste erschienen waren, lehnte sich Sindbad der Seefahrer auf seinem Stuhl zurück.
Liebe Brüder, sagte er. Höret nun die Geschichte von meiner dritten Reise, der Reise Sindbad des Seefahrers.
Die dritte Reise Sindbad des Seefahrers
Nach meiner zweiten Reise ging es mir wie nach der ersten. Die Tage gingen dahin und ich feierte viele Feste. Dann aber bekam ich wieder Fernweh. Ich merkte es daran, dass ich durch den Garten ging, die Vögel anschaute und dabei dachte: Ich sah im fremden Land viel schönere Vögel. Dann sah ich die Echsen an und dachte bei mir: Viel schönere Tiere sah ich im Diamantental. Und wenn ich in meinen Fischteich mit den roten Fischen schaute, sprach ich bei mir: Im Meer vor den Klippen der Inseln gab es buntere Fische.
In Bagdad blühten die Rosen und dufteten herrlich, doch ich dachte an den Duft der Wälder weit hinter dem Meer. Die Gesichter, die ich täglich sah, langweilten mich, und die Speisen, die es zu essen gab, schmeckten mir nicht mehr. So verändert sich das Herz des Menschen.
Das aber, liebe Brüder, war nicht allein der Grund dafür, dass ich ein weiteres Mal auf Reisen ging. Mich lockte auch, das muss ich offen zugeben, die Gier nach Gold und Edelsteinen. Mich hatte der Wunsch gepackt, reicher und reicher zu werden, um noch schönere und prunkvollere Feste geben zu können. Denn leider, meine Brüder, ist das Herz des Menschen schwach.
Und auch das, meine Freunde, ist nicht der einzige Grund. Ich war auch meine Erzählungen leid. Immer wieder nur hatte ich meinen Freunden dieselben Geschichten zu erzählen, und sie kannten sie alle schon. Ich wollte Neues erleben, mit dem ich meine Freunde beeindrucken und damit angeben konnte.
Dabei vergaß ich, dass Allah vor seine Rettung die Prüfung setzt, und dass man, bevor man mit einer Geschichte angeben kann Hartes erdulden muss. Das alles vergaß ich aus Eitelkeit und Leichtsinn, denn der Mensch ist eher eitel als klug.
So fuhr ich ein drittes Mal bei gutem Wind auf einem großen Schiff los. Wir fuhren von Küste zu Küste, kauften und verkauften und handelten mit unseren Waren.
Es kam wie es kommen musste. Wir gerieten in einen heftigen Sturm, der Wind brauste auf und die Wellen klatschten über Bord. Plötzlich starrte der Kapitän, ein kräftiger Mann, in die Ferne. Dann schrie er aus Leibeskräften: Rafft die Segel, so schnell ihr könnt und werft den Anker aus. Und er raufte sich verzweifelt die Haare und den Bart.
Die Matrosen gehorchten ihm so schnell sie konnten. Vor uns tauchte im Nebel eine Insel auf. Kapitän?, fragten wir ihn nun. Was ist geschehen? O schreckliches Schicksal, rief der Kapitän. Der Wind treibt uns den Bergen der Zuhb entgegen. Die Zuhb sind ein haariges Volk, die wie Affen aussehen. Niemand ist bei ihnen bis jetzt mit dem Leben davon gekommen. Darum sage ich euch, wir werden alle sterben.
Kaum hatte der Kapitän seinen Satz zu Ende gesprochen, kamen auch schon von allen Seiten Kanus auf unser Schiff zugefahren und die Affenmenschen fielen auf das Schiff ein. Diese Geschöpfe sahen wirklich schrecklich aus. Sie waren klein und kräftig, und ihr Körper war über und über mit schwarzem Fell bedeckt. Ihre Gesichter waren ebenfalls schwarz. Aus ihnen blitzten gelbe Augen hervor. Über ihre seltsame Sprache konnte niemand etwas sagen.
Wir beschlossen, nicht gegen sie zu kämpfen, denn sie waren in der Überzahl. Wenn wir angefangen hätten, die ersten von ihnen zu töten, hätten sie uns im Nu nieder gemacht. So standen wir da, die einen zitternd vor Angst, die anderen zitternd vor Wut, die dritten freundlich und bereit, mit ihnen zu verhandeln.
In großen Scharen belagerten sie unser Schiff, bissen oder schnitten die Seile durch und ließen das Schiff an die Küste treiben. Dann kamen sie schnatternd wie die Affen auf uns zu und trieben uns vom Schiff.
Allerdings verzichteten sie darauf, ihre Waffen gegen uns einzusetzen. Warum, konnten wir auch nicht sagen. Vielleicht erschienen wir ihnen zu groß, vielleicht waren sie aber auch im Grunde friedliche Wesen, es kann aber auch sein, dass sie es auf die Schätze auf dem Schiff abgesehen hatten.
Schnatternd und schreiend belagerten sie das Schiff und sorgten dafür, dass es ins Meer hinein fuhr, obwohl sie gar nicht in der Lage waren, es zu steuern. So trieben wir im Nebel dahin, bis wir erneut an einer Insel ankamen.
Nun stiegen wir aus und machten uns auf den Weg über die Insel. Wir wanderten und wanderten, aßen nebenbei köstliche Früchte und tranken aus klaren Quellen. So wanderten wir weiter, bis wir an einer Burg ankamen, die von einem Wall umringt war. In der Wallmauer befand sich ein großes Tor. Es war geöffnet.
Wir gingen in die Burg hinein und gelangten in einen großen kahlen Raum. An der einen Wand dort befand sich eine lange Bank. Ein Feuer war gezündet, und über ihm brutzelten zwei Bratspieße. Wir ließen uns alle dort nieder, und weil wir müde waren, schliefen wir schnell ein.
Als die Erde unter uns plötzlich erzitterte, erwachten wir erschrocken. Von den Zinnen der Burg aus kam uns ein großes behaartes Wesen entgegen. Es war groß wie ein Baum, dicht behaart und hatte lange Arme und Beine. Sein Maul war groß wie ein Brunnenloch.
Wir zitterten vor Angst. Der Riese starrte uns verwundert an, trampelte dann in den Raum und setzte sich auf die Bank. Dann starrte er uns an. Mit seiner riesigen Hand griff er in unsere Mitte, schubste den einen an die eine, den anderen an die andere Seite, als suche er einen bestimmten. Es kam wie es kommen sollte. Er griff mich an den Arm und hob mich auf.
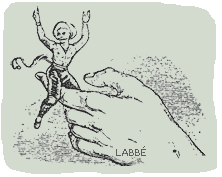
Warum ausgerechnet ich!, dachte ich verzweifelt. Allah, bitte hilf mir. Oh, warum musste ich denn auch auf diese Reise gehen. Er hob mich zu sich hinauf, schaute mich genau an und betastete mich wie ein Schlachter ein Schaf. Nun, durch den langen Marsch war ich dünn und mager geworden, und das schien ihm nicht zu gefallen. Er setzte mich wieder auf den Boden und ergriff einen anderen, den er ebenfalls betastete. Aber auch der schien ihm nicht zu gefallen, denn er wurde ebenfalls zurückgesetzt.
Jetzt betastete er einen nach dem anderen, bis er schließlich beim Kapitän angekommen war. Unser Kapitän war ein kräftiger, dicker, breitschultriger Mann. Er schien dem Riesen zu gefallen. Mit einem geübten Griff tötete der Riese den Kapitän und aß ihn wie ein Hühnchen auf. Der Schiffsjunge sank vor meinen Augen in Ohnmacht.
Nach diesem Mahl blieb der Riese eine Zeitlang bei uns sitzen und betrachtete uns nachdenklich. Bei Allah, er ist noch nicht satt, flüsterte der Matrose neben mir. Aber der Riese entschied sich anders. Er legte sich der Länge nach auf den Boden, rollte sich zusammen und schlief ein. Dabei schnarchte er wie ein schnaubendes Pferd. Als der Morgen kam, erwachte er, stand auf und ging seiner Wege. Die Tür schlug er fest hinter sich zu.
Dann sprachen wir miteinander. Oh wäre wir doch nur im Meer ertrunken, jammerten wir. So ein Tod ist heldenhafter, als von diesem Affen wie ein Hühnchen verspeist zu werden. Was für ein schrecklicher Tod! Und wir beteten und flehten um Hilfe. Nur der Schiffsjunge sagte kühn: Ich bin froh, dass ich klein und zierlich bin. Da bin ich wenigstens als letzter dran.
Doch der Steuermann sagte zu ihm: Das kannst du leider nicht voraussagen, die Dummkopf. Vielleicht will er ja nur eine kleine Vorspeise essen. So beschlossen wir, zusammen zu halten und suchten nach einem Ausgang der Burg. Wir fanden tatsächlich einen, gelangten nach draußen und liefen über die Insel. Wir aßen Beeren und Früchte, tranken Wasser und hielten uns versteckt. Doch als die Sonne unter ging, erbebte die Erde neben uns und der Riese stand wieder da.
Er bückte sich und fing uns alle ein, wie jemand, der ein Kaninchen einfängt. Wir waren machtlos gegen ihn, zu langsam und zu unbeholfen. Er steckte uns alle in einen Sack und trug uns davon.
In diesem Sack war es schrecklich. Wir lagen alle durcheinander und aufeinander, und niemand wusste, wessen Beine und wessen Arme es waren. Ich hatte Glück. Ich lag weit oben und auf mir nur noch der Schiffsjunge.
In der Burg öffnete der Riese den Sack und nahm einen nach dem anderen von uns heraus. Wieder betastete er uns alle und wählte sich einen Kaufmann, der einen dicken Bauch und dicke Beine hatte. Er tötete ihn, briet ihn und aß ihn auf. Dann legte er sich wieder in die Ecke und schlief ein. Dabei schnarchte er, wie ein Nilpferd. Als der Morgen kam, erhob er sich und ging davon.
Erneut berieten wir uns. Es ist zwecklos, zu fliehen, sagten wir uns. Soweit wir auch laufen, er holt uns mit ein paar Schritten wieder ein. Auf dieser Insel gibt es auch zu wenige Gelegenheiten, sich zu verstecken. So bleibt uns nur eine Möglichkeit, wir müssen den Riesen töten, wenn er schläft.
Aber was können wir gegen ihn aufbringen, sagten die anderen. Unsere schärfste Waffe ist für ihn wie ein Grashalm. Ich hätte noch eine andere Idee, schlug ich vor. Lasst uns ein Floß aus diesem Feuerholz bauen und damit fliehen. Vielleicht hilft uns Allah, von dieser schrecklichen Insel zu entkommen.
Und die anderen entgegneten: Du hast schon Recht, Sindbad, so müsste die Flucht möglich sein. Aber sie wird uns nur gelingen, wenn wir den Riesen loswerden können. Sa fiel mein Blick auf die beiden Bratenspieße hinter mir und ich sagte: Freunde, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir versuchen, diese Spieße in seine Augen zu stechen. Ich weiß, es ist eine grausame Tat, doch wir haben keine andere Wahl, wenn wir unser Leben retten wollen.
Schrecklich oder nicht. Wir haben doch kein Mitleid mit dem Riesen, der unsere Freunde und Kollegen gefressen hat, entgegnete der Steuermann. Auch heute Abend wird er wieder einen von uns fressen. Vielleicht bin sogar ich an der Reihe. Vielleicht aber auch du, mein Freund Sindbad, oder der Schiffsjunge. Darum sollten wir Sindbads Plan in die Tat umsetzen. Es gibt keinen besseren. Lasst uns Allah bitten, uns beizustehen.
Wir trugen Bretter zum Strand und bauten ein Floß. Als die Sonne im Meer versank, waren wir fertig. Wir sprangen auf das Floß und wollten so schnell wir konnten abstoßen, doch da erschien der Riese neben uns. Mit einem Griff packte er uns alle, trug uns in die Burg, fraß einen von uns, einen Reisenden aus Bassora, legte sich hin und schnarchte, wie ein trompetender Elefant.
Schnell nahmen wir die Bratspieße, schlichen auf den schlafenden Riesen zu, kletterten auf die Bank und stießen zu. Der Riese brüllte, und wir hatten das Gefühl, die Erde würde beben. Er versuchte, uns zu packen, aber wir wichen aus und rannten voller Panik davon.
Der Riese tastete sich zur Tür und lief brüllend in die Nacht hinaus. Wir stürzten zum Floß und hofften, der Riese würde uns nicht finden. Gerade waren wir dort hinauf geklettert, tauchte der Riese nicht weit von uns entfernt auf. Aber er war nicht allein. Links und rechts von ihm waren zwei weitere Riesen erschienen.
Wir lösten die Taue und stießen ab. Zu unserem Glück schleuderte uns eine Riesenwoge ins offene Meer, gerade als die drei Riesen den Strand erreichten. Als sie sahen, dass wir flohen, warfen sie große Felsblöcke hinter uns her. Die Felsblöcke fielen neben uns ins Wasser und sorgten dafür, dass das Floß hin und her geschleudert wurde.
Wir ruderten, so schnell wir konnten. Ein Felsbrocken traf das Floß. Einige von uns wurden erschlagen, andere fielen ins Meer, wo sie den Haien zum Opfer fielen. Immer mehr Felsbrocken kamen vom Strand aus geflogen. Viele von uns kamen bei dem Steinhagel ums Leben.
Wir anderen ruderten aus Leibeskräften. Und als wir schließlich von einem Sturm ergriffen hin und her geschleudert wurden und auf dem Strand einer Insel strandeten, waren nur noch drei Menschen übrig: ein junger Matrose, ein älterer Reisender und ich. Auf dem Strand liegend, fühlten wir uns mehr tot als lebendig.
Endlich konnten wir uns erheben und wir machten uns auf, die Insel zu erkunden. Es gab Bäume mit wundervollen Früchten, Vögeln, Schildkröten, Wasser und Blumen im Überfluss. Wir aßen uns an den Früchten satt und waren froh über unsere wundervolle Rettung. Ruhig legten wir uns schlafen.
Dann aber wurden wir von einem Zischen geweckt, das wie das Pfeifen eines Windes schien. Vor unseren Augen war eine Schlange aufgetaucht. Sie war groß wie ein Drachen und hatte mit ihrem Körper einen Kreis um uns herum gelegt.
Ihr Gesicht kam ganz dicht an den jungen Matrosen heran. Dann packte sie ihn plötzlich und verschlang ihn mit einem Biss. Danach kroch sie wieder davon. Nun waren wir nur noch zu zweit und wir waren sehr verzweifelt.
Immer wenn man glaubt, der einen Todesart entkommen zu sein, erwartet einen eine neue, die noch viel schauriger ist als die erste, sagte ich. Denn es ist doch fast schlimmer, wenn man von einer Schlange gefressen wird, als wenn man von einem Riesen zertreten wird.
Da erwiderte der ältere Reisende: Oh Freund, der Tod hat immer zwei Seiten. Es ist schlimm, zu sterben, aber man wird ja auch von allen Plagen auf Erden befreit und die Seele steigt ins Paradies empor. Ob man von Haien gefressen, von Steinen erschlagen, von Riesen zertreten oder von Schlangen verspeist wird, ich werde dem Tod ins Auge sehen. Ich bin bereit für meine letzte Reise.
Es war wohl weise, was er sagte, und man konnte sehen, dass er sich nicht mehr fürchtete. Ich aber flehte zu Allah und bat um mein Leben. Mein Gefährte und ich kletterten auf einen Baum, um uns vor der Schlange in Sicherheit zu bringen, doch sie kletterte hinter uns her, ergriff meinen Gefährten und verschlang ihn. Dann glitt sie davon.
Als die Sonne schien, stieg ich vom Baum herunter. Ich war vor Angst wie gelähmt und wusste nicht, was ich machen sollte. Zuerst überlegte ich, mich ins Meer zu werfen, aber ich konnte mich nicht dazu überwinden. Das Leben war einfach zu schön.
So nahm ich verschiedene Holzbalken, band mir eins quer unter die Füße, ein anderes links und rechts über die Brust, das Breiteste aber legte ich über meinen Kopf. So legte ich mich auf den Rücken, die Balken umschützten mich nun wie einen Holzsarg.
Als der Tag zu Ende ging, kroch die Schlange aus ihrem Versteck auf mich zu und versuchte, mich zu verschlingen. Es gelang ihr aber nicht. Die Holzbalken waren breiter als ihr Rachen. Sie ringelte sich zischend um mich herum und versuchte von allen Seiten, an mich heran zu kommen, aber es gelang ihr nicht.
So wartete sie neben mir, bis die Sonne wieder hervor kam. Dann machte sie sich fauchend und wütend davon. Ich löste die Balken von mir und streckte mich. Ich war müde und steif von der ungemütlichen Nacht. Müde ging ich hinunter zum Strand und starrte auf das Meer hinaus. Dabei glaubte ich, meinen Augen nicht zu trauen. In der Ferne tauchte ein Schiff auf.
Ich riss einen großen Zweig ab und begann, zu winken, und das Segelboot nahm tatsächlich Kurs auf mich. Mit einem kleinen Boot holten sie mich von der Insel ab und brachten mich in ihr Segelboot. Ich erzählte allen meine schreckliche Geschichte, und man gab mir zu essen und zu trinken.
Ich brauchte drei Tage, bis ich mich von meinem Schrecken erholt hatte. Dann dankte ich Allah dem Allerhöchsten für seine wundervolle Rettung. Doch nach drei Tagen erschien mir das alles nur noch wie ein böser Albtraum.
Wir segelten weiter und erreichten die Insel Aes-Salahitah. Sie ist wunderschön und reich an Sandelholz. Alle Kaufleute gingen mit ihren Waren an Land, doch ich blieb im Schiff sitzen. Was ist mit dir?, fragte mich der Kapitän. Warum gehst du nicht an Land und schaust dich um.
Ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche Abenteuer, erwiderte ich. Ich möchte viel lieber eine Weile lang meine Ruhe haben. Ich habe auch überhaupt keine Waren mehr, außer eben mein nacktes Leben, und dafür bin ich Allah dankbar.
Du hast zwar keine Waren, aber du besitzt zwei interessante Ringe, sagte der Kapitän. Davon scheint mir der eine besonders kostbar zu sein. Ich betrachtete meine Ringe. Der eine war der Ring des Königs Mihrdschan, der andere bestand aus zwei Schlangen, deren Augen aus zwei Rubinen bestanden.
Ich fand die Idee des Kapitäns gut und ging vom Schiff. Im Hafen zeigte ich zunächst den Ring des Königs, weil er mir wertvoller erschien, aber ein Reisender griff nach dem Schlangenring.
Diesen Ring hätte ich gerne, sagte er. Er erinnert mich an ein Tal, in dem ich schon einmal war, und in dem es solche Schlangen gab. Ich fragte ihn, welches Tal er meine, und er sagte, es sei das Diamantental. Nun sah ich mir den Mann genauer an und erkannte in ihm den Kaufmann, der mich durch seinen toten Hammel gerettet hatte und dem ich viele meiner Steine geschenkt hatte.
Oh Vater des Hammels, erkennst du mich?, fragte ich. Du sagtest damals, mein Herz sei aus Diamanten, erinnerte sich der Mann. Da lachten und umarmten wir uns. Und da ich nun in Not war, er aber im Überfluss lebte, gab er mir von seinen Steinen ab. Ich schenkte ihm dafür den Ring. So blieb mir der Ring des Königs erhalten, von dem anderen aber wurde ich reich. Ich kaufte und verkaufte meine Dinge in vielen Häfen, und so wurde ich wieder so reich wie früher.
Ich erlebte auf dieser Reise noch so manches Wunderbare. Ich sah einen riesigen Fisch, der bekam Junge wie ein Mensch und säugte sie wie eine Elefantenmutter ihre Kinder. Ich sah auch ein Tier im Meer, das glich einer Kuh. Es konnte im Wasser und auf dem Land leben. Dann sah ich Fische, die auf Bäume klettern konnten. Und eine Schildkröte sah ich, die zwanzig Ellen breit war. Auf ihrem riesigen Panzer hatte sie silberne Sterne.
Es gab auch ein Tier, das einer Robbe glich, aber einen Kopf wie eine Schlange hatte. Und in der Tiefe des Meeres sah ich Fische, die leuchteten wie Laternen. In all diesen Ländern machte ich gute Geschäfte, und so kehrte ich als reicher Mann nach Bassora zurück. Hier blieb ich einige Tage, bis ich dann nach Bagdad, meiner Heimat, zurückkehrte.
Hier gab ich wieder viele Feste, half den Armen mit Geschenken und Spenden und verhielt mich allen gegenüber großzügig. Und irgendwann hatte ich auch die Schrecken vergessen, die ich erlebt hatte. Ich hatte das Gefühl, das alles nur erlebt zu haben, um davon erzählen zu können und um mich im Ruhm des Weitgereisten sonnen zu können.
Ach Freunde, so ist das mit dem Gedächtnis. Es ist nur kurz, und schnell sind die finsteren Stunden vergessen, in denen man Allah anflehte und ihm Dank schuldete. Und so war das die Geschichte meiner dritten Reise. Morgen, wenn Allah es will, will ich von meiner vierten Reise erzählen.
Dann ließ Sindbad der Vielgereiste Sindbad dem Lastträger hundert Dinare reichen und wartete, bis Sindbad der Lastträger am nächsten Tag zum Frühstück wieder erschien. Als alle Gäste versammelt waren, ließ Sindbad der Seefahrer das Essen auftragen und lud alle ein, mitzuessen. Dann erzählte er von seiner vierten Reise.
Die vierte Reise Sindbad des Seefahrers
Eines Tages erhielt ich viel Besuch von verschiedenen Kaufleuten. Sie erzählten mir von ihren Fahrten und ihren Gewinnen, und berichteten farbenfroh über ihre Reisen, dass ich all meine Bedenken vergaß. All mein Fernweh erwachte erneut, und es reizte mich, in die Ferne hinaus zu ziehen.
Ich suchte Geld und Waren zusammen und nahm mit meinen Besuchern zusammen dasselbe Schiff. Als ein günstiger Wind über dem Hafen von Bassora stand, stießen wir in See.
Doch der Wind blieb nicht lange so ruhig, er entwickelte sich schnell zu einem tosenden Orkan. Wir warfen mitten im Meer den Anker, doch das nützte uns nichts. Der Wind ließ unseren Mast brechen und riss unsere Segel in Fetzen. Dann riss auch der Anker.
Kaum hatten wir unsere Reise begonnen, sank das Schiff mit all unseren Waren vor unseren Augen. Wir sprangen in die Rettungsboote, doch der Sturm schaukelte sie auf den Wellen wild hin und her, sodass sie zerschmetterten. Ich stürzte ins Meer.
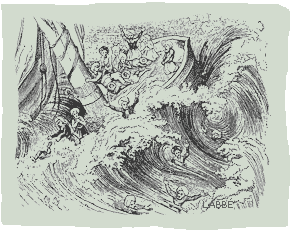
Ich war ein guter Schwimmer, und trotz Sturm gelang es mir, mich auf dem Wasser zu halten. Dann legte sich der Wind. Mir trieb eine Schiffsplanke in den Weg, auf der einige Kaufleute saßen, und ich klammerte mich daran fest und kletterte ebenfalls hinauf. So ritten wir zwei Tage und zwei Nächte durch die Wellen. Dann wallte das Meer erneut auf und warf uns an den Strand einer Insel. Wieder lag ich schiffsbrüchig an einem fremden Strand.
Wir gingen an der Küste der Insel entlang, aßen Kräuter und Vogeleier und fanden einen Platz zum Schlafen. Der Morgen erwachte mit einem glitzernden Sonnenaufgang auf dem Meer. Wir waren guter Dinge und durchwanderten die Insel, bis wir auf ein fremdes Gebäude trafen. Wir wollten gerade auf das Tor zugehen, da stürmten nackte Männer auf und zu, warfen sich auf uns, überwältigten uns und brachten uns gefesselt zu ihrem König.
Der König wirkte zum Glück gelassen und freundlich, er ließ uns die Fesseln abnehmen und bat uns, uns zu setzen. Dann ließ er uns Essen kommen. Das Essen sah seltsam aus und wir blieben misstrauisch. Besonders ich ekelte mich allein von dem Geruch. Meine Freunde aber waren hungrig, überwanden ihren Ekel und aßen schließlich davon.
Danach ging eine schreckliche Veränderung in ihnen vor. Eigentlich waren es gut erzogene höfliche Männer, doch nun verwandelten sie sich in gierige, schmatzende, fressende Wesen. Knurrend und gurrend fielen sie über das Essen her.
Ich fragte mich, was in sie gefahren war und hielt mich zurück. Nur von den Früchten, die ich kannte, aß ich ein bisschen. Als man uns ein Getränk anbot, weigerte ich mich erneut, davon zu nehmen, meine Freunde aber schütteten es in sich hinein und schienen danach vollends betrunken zu sein.
Da ich der einzige war, der sich nicht so seltsam aufführte, kam ich mir am Ende selbst verrückt vor. Dann aber sah ich mich um und bemerkte, wie die nackten Wilden unsere Männer grinsend betrachteten und auch der König ein böses Aussehen hatte. Durch mein Beobachten entdeckte ich die Wahrheit.
So bemerkte ich in den nächsten Tagen, dass die Wilden einem Stamm von kannibalischen Zauberern angehörten und ihr König ein Oger, ein Menschen fressender Satan war. Er war riesengroß und stark. Er war begierig auf Menschenfleisch und hatte seinen Spaß an allen erdenklichen Grausamkeiten.
Die Speisen waren nur dazu da, den Magen der Menschen zu erweitern und den Heißhunger zu verstärken. So begannen die Menschen zu fressen, wurde immer fetter und vergaßen das Denken. Wenn sie aber wie Schweine gemästet waren, schnitt man ihnen die Gurgel durch, briet sie in einer riesigen Pfanne und brachte sie dem König. Die nackten Wilden aber aßen das Menschenfleisch sogar roh.
Ich war verzweifelt und versuchte, meine Freunde mit Bitten und Beschwörungen von ihrem Fressen abzubringen, aber sie waren bereits so schwachsinnig geworden, dass sie nicht auf mich hörten. Die Wilden trieben sie jeden Tag auf die Wiese hinaus wie Vieh, und weideten sie im grünen Gras. So wurden sie von Tag zu Tag fetter.
Ich dagegen wurde immer dünner, einmal, weil ich nur Früchte aß, zum anderen weil Kummer und Angst an mir zehrten. Die Wilden verloren ihr Interesse an mir, ich meinerseits gab mir Mühe, so unauffällig wie möglich zu bleiben. So hatte ich eines Tages die Möglichkeit, zu fliehen. Ich versteckte mich im Wald und ernährte mich dort von Früchten, Kräutern und Vogeleiern, bis ich wieder zu Kräften kam.
Weiter und weiter wanderte ich durch den Wald, bis ich schließlich an Feuerstellen auf die Spuren von Menschen traf. Und dann eines Tages sah ich von Ferne menschliche Gestalten. Vorsichtig schlich in näher und beobachtete sie, ich erkannte aber zu meiner Erleichterung, dass es Menschen waren, die im Wald Pfefferkörner ernteten.
So ging ich auf sie zu, grüßte sie und wünschte ihnen Frieden. Sie wollten wissen, wer ich war und woher ich kam und ich erzählte ihnen von den Kannibalen, den ich entflohen war. Sie staunten über mich. Bei Allah, du bist der erste, der ihnen entkommen konnte, sagten sie mir. Denn sie verstehen es, einen Menschen mit einem dunklen Zauber zu überdecken. Noch größer als ihr Zauber ist jedoch die Macht unseres Höchsten, sagte ich.
Gemeinsam dankten wir Allah und beteten für meine Weggefährten. Dann stiegen die Pfeffersammler mit mir in ihr Schiff und segelten zu ihrer Heimatinsel. Sie lebten in einem schönen Land voller Menschen, die sehr gläubig waren. Doch die Kultur hier war nicht so hoch wie in Bagdad.
Eines Tages führten mich die Pfeffersammler zu ihrem König. Ich erzählte ihm, was ich erlebt hatte, und er war interessiert an meinen Geschichten. Dann schenkte er mir ein schönes Gewand und einen Dolch, der mit edlen Edelsteinen und Elfenbein besetzt war. Ich freute mich sehr darüber.
Danach schlenderte ich über den Markt und freute mich über das bunte Treiben und die schönen Waren, die es hier zu kaufen gab. Ich betrachtete die Krebse und Langusten, die Früchte und Vögel, den interessanten Pfeffermarkt und den Pferdemarkt.
Hier blieb ich besonders lange, weil ich die Pferde sehr liebte. In diesem Land waren die Pferde hoch angesehen und es gab wunderschöne. Alle Menschen besaßen Pferde, selbst die ärmeren Menschen. Und alle ritten ohne Sattel und Steigbügel. Das erstaunte mich sehr und ich nahm mir vor, das dem König zu erzählen.
Warum, oh mein Herrscher, reitet ihr nicht mit einem Sattel?, fragte ich ihn. Es ist viel leichter mit Sattel zu reiten, und es spart den Menschen viel Kraft. Ich weiß gar nicht, was das ist, sagte der König. Noch nie habe ich so etwas gesehen oder auch nur davon gehört.
Wenn ihr gestattet, werde ich einen Sattel anfertigen lassen, sagte ich. Dann könnt ihr euch von dem komfortablen Reiten selbst überzeugen. Der König war höchst interessiert. So ließ ich Holz und Leder kommen und bat um tüchtige Handwerker. Man brachte mir zehn davon.
Ich suchte mir den geschicktesten Zimmermann aus und malte ihm auf, wie man einen Sattelbaum anfertigte. Dann fertigte ich aus Wolle Filz an, überzog den Sattelbaum mit Leder und stopfte den Rest mit Filz aus. Anschließend ließ ich einen Schmied die Steigbügel und das Gebiss anfertigen. Er schmiedete schöne Steigbügel und ein Gebiss, feilte alles glatt und verzinnte es. Ich zog die Zügelriemen durch und verzierte das Zaumzeug mit schönen bunten Fransen aus Seide.
Nun ließen wir das schönste Pferd kommen, zäumten es auf, sattelten es und führten es dem König vor. Er stieg auf und war sehr begeistert von der neuen Art und Weise, zu reiten. So wurde ich reich für meine Arbeit belohnt.
Nun wollte auch der Wesir des Königs so einen Sattel haben. Auch die Hofleute und Würdenträger verlangten Sättel und Zaumzeug, und so hatte ich alle Hände voll zu tun. Ich suchte mir Zimmermänner und Schmiede, unterrichtete sie im Handwerk und eröffnete eine Sattelwerkstatt und ein Geschäft.
Schon nach kurzer Zeit brachte ich es zu großem Wohlstand und Ansehen. Besonders der König liebte es, mit mir zu reden. Wir sprachen nicht nur über Pferde und Sättel, wir redeten auch über das Land, und der König interessierte sich für meine Ratschläge.
Als ich eines Tages wieder mit dem König zusammen saß, sagte er zu mir: Du bist einer von uns geworden, Sindbad, und dein Rat ist mir gut und wichtig geworden. So möchte ich dir etwas erzählen und erwarte in dieser Sache deine Zustimmung.
Ich verneigte mich und sagte: Ich höre, oh Herr. Ich möchte dich gerne mit einer schönen und klugen Frau verheiraten, die dazu noch reich ist, sagte der König. Dann gehörst du auch von deiner Herkunft zu uns. Deine Wohnung soll in unserem Palast sein, denn ich möchte dich täglich in meiner Nähe wissen.
Ich war gerührt von der Güte des Königs. Selbst hatte ich schon oft daran gedacht, zu heiraten, aber mir war es lieber, eine Frau in meiner Heimatstadt Bagdad zu suchen. Ich war mir auch nicht sicher, ob der König wirklich die richtige Frau für mich aussuchen würde. Ich versuchte, Zeit zu gewinnen und bat den König, zunächst einmal das Mädchen kennen zu lernen.
Doch als mir nun ein wunderschönes Mädchen gegenüber stand, da wurde mein Herz angerührt, und ich fühlte mich von diesem Mädchen angezogen. So dankte ich Allah für sein gutes Schicksal. Wir heirateten und waren sehr glücklich miteinander.
Nun begann eine wunderschöne und glückliche Zeit für mich, die nicht schöner hätte sein können, wenn mich nicht hin und wieder das Heimweh geplagt hätte, das immer mal wieder über mich kam. Ich liebte meine Frau über alles, aber ich dachte oft an meine Heimat und dachte dabei: Wenn ich in meine Heimat zurück kehre, werde ich sie mit nehmen.
Und hin und wieder schmiedete ich Pläne, zurück zu gehen. Aber die Dinge geschehen so, wie sie vorbestimmt sind, und niemand kennt die Zukunft.
Lange Zeit lebten wir zufrieden und glücklich. Dann aber eines Tages geschah es, dass meinem Nachbarn die Frau starb. Er war mein Freund, und ich ging zu ihm und versuchte, ihn zu trösten.
Mein guter Freund, auch wenn du zerrissen bist vom Schmerz, eines Tages wird die Zeit deine Seele heilen. Allah hat dein Leben so bestimmt, und niemand weiß, wozu er dich noch führen wird. Vielleicht, mein Lieber, findest du eine andere Frau, die noch besser und schöner ist. Jeder Mensch muss sterben, aber das Leben geht weiter, und die Toten haben es bei Allah gut.
Niemals werde ich eine andere Frau heiraten, erwiderte mein Freund, denn ich habe nur noch einen einzigen Tag zu leben. Oh mein Freund, rief ich. Sei vernünftig. Du solltest dein Leben nicht so einfach wegwerfen. Du bist noch jung und gesund. Allah wird dir noch viele Jahre schenken.
Was redest du da, mein Freund, rief der Nachbar. Schon morgen werde ich sterben und nie mehr da sein. Aber warum den?, fragte ich verwirrt.
Es ist so Brauch bei uns, erwiderte er. Wenn deine Frau heute stirbt, wirst du schon am nächsten Tag mit ihr in einer Gruft beerdigt. Und genauso verfahren sie mit der Frau, wenn der Mann stirbt. Er schluchzte. So hat man bei der Beerdigung seiner Frau einen doppelten Grund zu weinen. Einmal, weil die Frau gestorben ist, zum anderen, weil man selbst sterben wird.
Was ist das denn für ein schrecklicher Brauch!, schrie ich erschrocken. Warum hat mir niemand davon erzählt. Oh Allah, bei welchen Menschen lebe ich denn hier?
Aber es geschah so, wie unser Nachbar uns erzählt hatte. Sie trugen die Verstorbene aus der Stadt, zu den Bergen im Inneren der Insel. Dort legte man einen Felsblock zur Seite, der einen Schacht frei gab. Dieser Schacht führte in eine unterirdische Höhle.
Die Tote wurde nun in den Schacht hinunter gelassen. Dann wurde auch mein Freund an einem Seil in die Tiefe gesenkt. Man reichte ihm einen Krug frisches Wasser und sieben Brote. Dann schnitt er das Seil ab, winkte einen letzten Gruß und wir sahen ihn zum letzten Mal. Der Schacht wurde erneut mit einem Fels verschlossen.
Entsetzt lief ich zum König. Warum begrabt ihr die Lebenden mit den Toten?, fragte ich ihn. Es ist so Sitte bei uns, sagte er. Schon unsere Vorfahren machten es so. Es war immer so und wird immer so sein. Freud und Leid der Eheleute werden miteinander geteilt. Die Freude des einen ist die Freude des anderen und das Ende des einen bedeutet auch das Ende des anderen.
Ich verstand die Welt nicht mehr. Wie ist es mit den Fremden bei euch, die wie ich eure Sitte nicht kannten. Werde ich auch mit meiner Frau zusammen beerdigt, wenn sie vor mir stirbt, obwohl ich doch ein Fremder bin?, fragte ich entsetzt. Gewiss werden wir das tun, erwiderte der König. Denn das sind unsere Gesetze und nach denen richten wir uns immer.
Als ich das hörte, war ich voller Angst. Meine Angst wurde von Tag zu Tag größer und ich wagte mich kaum noch unter Menschen. Besonders groß aber war die Angst, meine Frau könnte sterben.
Eine Weile lang vergaß ich meinen Kummer und lenkte mich durch meine Arbeit ab. Als ich meine Angst fast vergessen hatte, wurde meine Frau sehr schwer krank, und dann eines Tages nahm Allah sie von mir. Der König und alle meine Freunde kamen zu mir um mit mir zu weinen und zu trauern.
Dann trugen sie die geschmückte Tote zu dem Berg, wo man sie in dem Schacht versenken wollte. Anschließend kamen alle zu mir und verabschiedeten sich von mir. Ich aber wollte nicht sterben.
So schrie ich verzweifelt: Das ist nicht Allahs Wille. Er gestattet niemals, einen lebendigen Menschen zu bestatten. Versteht doch, ich bin niemand von euch. Ich bin ein Fremder und eure Sitte ist mir unbekannt. Wenn ich sie gekannt hätte, wäre ich nie bei euch geblieben. Versteht ihr denn nicht? Ihr seid Mörder. Was haben die Toten davon, wenn ihr Gatte mit ihnen begraben wird. Sie sind doch schon im ewigen Friedensland.
Aber niemand beachtete mich. Mir wurde ein Leichentuch übergelegt und mit Seilen wurde ich in die Tiefe gelassen. Dann reichte man mir einen Krug Wasser und sieben Brote, wie es die Sitte vorschrieb. Bekümmert, weil ich ihre Sitte nicht mochte, nahmen sie trotzdem Abschied, lösten das Seil und rollten den Stein vor die Tür.
So war ich allein. Ich sah mich um. Um mich herum lagen tote Gebeine und ein furchtbarer Leichengeruch durchströmte die Luft. Bei Allah, sagte ich mir. Es ist alles meine eigene Schuld. Warum muss ich in einem fremden Land leben und mich hier auch noch um die Gunst des Königs bemühen.
Ich wollte ein angesehener Mann werden. Ich wollte Geschäfte machen. Ich war von Ruhm und Ehrgeiz getrieben. Ich wollte diese Frau besitzen, aber hätte ich sie auch geheiratet, wenn der König mich nicht darum gebeten hätte? Und war nicht bei aller Liebe auch immer die Angst da, sie würde eher sterben als ich? Und ist das dann wirklich Liebe?
Und wenn mir meine innere Stimme sagte, ich solle in meine Heimat zurückkehren, warum folgte ich ihr nicht? Ich war gefesselt vom Wunsch nach Ruhm und der Gier nach Gewinn. Ich habe im Grunde alles, was mir nun zugestoßen ist, verdient.
Aber dann fraget ich mich auch: Warum bin ich dann nicht gleich im Meer ertrunken? Warum stürzte ich nicht in den Bergen ab? Und warum war ich bis jetzt nicht wie ein guter Mann und Moslem eines natürlichen Todes gestorben? Hatte Allah dieses Schicksal für mich vorgesehen? Wenn ja, durfte ich mich nicht verweigern, sondern mich für den Tod bereithalten.
Und so setzte ich mich zwischen die Toten und atmete schwer. Ich erlebte wirklich eine schreckliche Nacht, und am nächsten Tag aß ich ein bisschen von den Broten und trank von dem Wasser. Dann erkundete ich die Höhle.
Der Boden der Höhle war mit Knochen und Schädeln bedeckt, sodass ich kaum Platz fand. Ich machte mir in einer Nische ein Lager für die Nacht. Dann legte ich mich nieder. So verbrachte ich einige Zeit, bis mein Brot und mein Wasser allmählich zur Neige ging. Und obwohl ich sehr hungrig war, aß und trank ich nur wenig.
Auch wenn ich mich auf den Tod einstellte, hoffte ich doch insgeheim, dass Allah eine Rettung für mich vorgesehen hatte. Dann eines Tages erwachte ich und nahm einen Schatten war, der aus der Höhle kam. Ich griff mir einen Knochen und fasste ihn wie eine Waffe. Dann folgte ich dem Geräusch und nahm einen Schatten war.
Es war ein Wolf oder ein Schakal, der in der Höhle vor mir aufgetaucht war und nun schnell vor mir davon lief. Ich verfolgte das Tier und sah, dass es in der Ferne verschwand. Dann entdeckte ich in der Ferne einen Lichtpunkt. Es war ein Stern.
Je weiter ich ihm entgegen ging, desto größer wurde er. Dann sah ich eine Spalte in der Felswand, die ins Freie führte. Zuerst war ich unsicher, aber dann sah ich klar, dass es ein Bruch im Gestein war. Zunächst war es vielleicht eine schmale Spalte gewesen. Die Tiere hatten es aber so weit verbreitert, dass sie hinein und hinaus kriechen konnten, um die Toten zu verspeisen.
Als ich das sah, kehrten meine Lebensgeister zurück. Ich kroch aus der Spalte und kehrte zurück ins Leben. Zunächst wurde ich vom Licht geblendet, doch all meine Freude am Leben kehrte zurück, und ich war überglücklich.
Als ich dann aber sah, wo ich gelandet war, war ich erschrocken. Ich befand mich nämlich auf einem hohen Felsen, der vom Meer umgeben war. Der Abstieg aber war sehr gefährlich. Trotzdem danke ich Allah für seine wunderbare Rettung und machte mich vorsichtig an den Abstieg.
Nach all den schrecklichen Erlebnissen war der Abstieg im Verhältnis dazu leicht, und so erreichte ich irgendwann die Küste. Dort fand ich nicht nur Früchte und Vogeleier zum Essen, sondern auch Muscheln, in denen Perlen steckten.
Diese Muscheln fand ich ganz zufällig, als ich zwischen den Fischen umher schwamm, um mich abzukühlen. Die Perlen, die in den Muscheln leuchteten, waren silbern und waren so rein wie Wasser.
Hier lebte ich nun eine Zeitlang, und da ich täglich nach Perlen tauchte, konnte ich mir einen größeren Reichtum aneignen. Die Einsamkeit, die ich hier erlebte, machte mir keine Angst. Im Gegenteil, ich fühlte mich frei und sicher.
Ich baute mir eine Höhle, lebte mit den Tieren, die in diesem Felsen lebten und ordnete und polierte meine Perlen. Ich errichtete mir eine Feuerstelle, ich knüpfte mir ein Netz zum Fischen und errichtete mir ein Lager aus Pflanzen. Wenn die Hitze mittags zu groß wurde, legte ich mich in eine Erdhöhle, die Schildkröten errichtet hatten.
Dann eines Tages geschah das Unfassbare. Ich sah ein Schiff und sandte Signale aus. Das Schiff bemerkte mich und steuerte auf mich zu. Die Besatzung an Bord betrachtete mich verwundert, denn ich trug ja immer noch meine Leichentücher, die man mir zur Bestattung angezogen hatte.
Ich erzählte ihnen meine Geschichte, berichtete aber nicht, dass ich mit meiner Frau beerdigt worden war, weil ich nicht wusste, ob sie so einen Brauch gut finden würden, und mich dann zurück unter die Erde bringen würden. Erst später erfuhr ich, dass sie diesen Brauch nicht kannten. So hätte ich ihnen auch die Wahrheit sagen können.
Ich bot dem Kapitän meine Perlen an, wenn er mich nach Bagdad bringen würde, doch er wollte sie nicht annehmen. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, einem Menschen zu helfen, der in Seenot geraten ist, sagten sie. Wir kleiden ihn an, wir geben ihm zu essen und wir bringen ihn nach Hause, weil Allah es von uns verlangt. Wir wollen deine Geschenke nicht, im Gegenteil machen wir dir Geschenke. Teile einfach dein Leben mit uns, während du an See bist, und dann bringen wir dich in deine Heimat zurück.
Ich stieg auf das Schiff und bat Allah um seinen Segen. Schnell wurden die Mannschaft und ich gute Freunde, und da ich ein erfahrener Seefahrer war, konnte ich mich schnell nützlich machen.
Wir fuhren von Insel zu Insel, erreichten die Glockeninsel, machten Fahrt zur Insel Kala, wo ein mächtiger König regiert und landeten schließlich nach langer Fahrt in der Stadt Bassora. Nun war es nicht mehr weit nach Bagdad.
Nach nicht allzu langer Zeit konnte ich mein Haus wieder betreten. Ich lagerte all meine Waren und dann gab ich für alle Witwen und Waisen ein großes Fest, machte den Armen Geschenke und ließ meine Verwandten an meinem Reichtum Anteil haben. Überglücklich über meine Rettung dankte ich Allah, dem Allmächtigen.
Dies ist die Geschichte meiner vierten Reise, und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne morgen meine fünfte Reise erfahren. Aber du, lieber Sindbad, der du lieber auf dem Land als auf dem Wasser lebst, bist herzlich zum Abendessen eingeladen.
Nach dem Abendessen ließ Sindbad der Seefahrer Sindbad dem Lastträger wieder hundert Dinare reichen, dann ging der nach Hause. Am nächsten Tag aber fand er sich nach dem Frühstück im Hause seines Namensvetters ein und wartete, wie die anderen Gäste darauf, dass Sindbad der Seefahrer erzählte. Und er begann die Geschichte seiner fünften Reise.
Die fünfte Reise von Sindbad dem Seefahrer
Eines Tages gingen meine Geschäfte schlechter, und ich erinnerte mich an die schöne Küste, wo ich diese wundervollen Perlen gefunden hatte, die es dort im Überfluss gab. Es war nicht wirklich so, dass ich mich wegen der Geschäfte beunruhigen musste - ich hatte immer noch genug Hab und Gut zum Leben - aber ihr wisst ja, ich habe diese innere Unruhe.
Es ist diese Sehnsucht nach dem Meer, nach Abenteuern. Ich bezähmte mich, denn ich wollte nicht wieder meinem Übermut nachgeben, doch sobald ich über meine Lage nachdachte, schlug mein Herz voller Sehnsucht nach der weiten Welt.
So beschloss ich erneut, die Perlenküste aufzusuchen, um mit neuen Schätzen heim zu kehren. Diesmal kaufte ich ein eigenes Schiff, suchte einen guten Kapitän, stellte eine Mannschaft zusammen und nahm etliche Diener und Sklaven mit. Als der Kapitän den Befehl zur Abfahrt gab, setzten wir die Segel, lichteten den Anker und starteten. Wir hatten einen guten Wind.
Es war eine lange Reise. Zunächst schien alles unter einem guten Stern zu stehen, dann aber fanden wir die Küste mit den Perlen nicht wieder. Es begegnete uns ein Schiff, das aus der Richtung kam und half uns auf den Kurs, dann aber erreichte uns ein Sturm und wir wurden in eine andere Gegend getrieben.
Der Sturm hinterließ keine Schäden, aber wir waren gezwungen, eine unbekannte Insel anzulaufen. Vom Schiff aus sah ich eine seltsame Kuppel, und ich erinnerte mich, schon einmal eine solche Kuppel gesehen zu haben, aber ich konnte mich beim besten Willen nicht daran erinnern, wo das damals gewesen sein konnte.
Die Matrosen waren sehr neugierig über dieses seltsame Bauwerk, und sie baten den Kapitän, an Land gehen zu können, um es sich näher anzusehen. Ich blieb an Bord und wartete auf sie. Dann kamen sie zurück und erzählten: Diese Kuppel ist gar keine Kuppel, sondern ein riesengroßes Ei, erzählten sie. Und etwas kleinere Eier, aber noch viel größere, als alle Eier, die wir bis jetzt gesehen hatte, lagen dort in der Nähe.
Jetzt fiel es mir plötzlich ein, wo ich diese Eier schon einmal gesehen hatte. Das sind die Eier des Vogels Roch!, rief ich. Das kann wohl sein, sagte einer der Matrosen. Jedenfalls haben wir viel Mühe damit gehabt, sie zu zerstören. Die Schale war sehr hart.
Was habt ihr gemacht?, schrie ich entsetzt. Ihr habt doch wohl nicht etwa die Eier zerstört? Oh, ihr Unglücklichen, warum seid ihr bloß mit so viel Einfältigkeit ausgezeichnet. Euer Unfug setzt uns jetzt einer großen Gefahr aus.
So ein Unsinn!, widersprach der Matrose. Und genau genommen haben wir es auch nur geschafft, ein kleineres Ei zu zerstören. Das Große war gar nicht kaputt zu kriegen. Um Himmels Willen, rief ich verzweifelt. Das zeigt ja, dass mehrere Vögel auf der Insel leben. Freunde, glaubt mir, ich bin bereits so einem Vogel begegnet. Er ist so groß wie ein Haus. Darum rate ich euch, lasst uns sofort abfahren, bevor der Vogel Roch zu uns kommt und uns alle vernichtet.
Da lachten die Matrosen und der Kapitän schüttelte über mich den Kopf. Wir stritten hin und her und verschwendeten kostbare Zeit. Dann sagte der Kapitän: Es scheint ein Sturm herauf zu ziehen. Der Himmel bedeckt sich bereits mit schwarzen Wolken.
Wir sahen zum Himmel und stellten fest, dass es keine Wolken waren, die da auf uns zukamen, sondern riesige Vögel. Sie waren schwarz wie die Nacht. Nun glaubten mir zwar meine Kollegen, aber es war zu spät.
Lasst uns in See stechen, rief ich. Wir fuhren so schnell wir konnten los. Doch es war zu spät. Mit einem riesigen Schrei stürzten die Vögel auf uns zu. Wir arbeiteten fieberhaft, um loszufahren. Schnell erreichte unser Schiff eine gute Geschwindigkeit. Und der Matrose, der eben noch über mich gelacht hatte, schrie laut vor Angst: Hilfe. Was für grauenhafte riesige Vögel.
Im Nu hatten uns die riesigen Vögel umkreist. Wir sahen erst jetzt, dass sie Felsbrocken zwischen ihren Fängen hatte. So etwas hatten wir alle nie zuvor gesehen. Die Vögel flogen nun direkt über uns, öffneten ihre Krallen und ließen die Felsbrocken auf uns fallen.
Einer der Felsbrocken schlug direkt neben dem Schiff auf und schlug so hohe Wellen, dass unser Schiff in die Höhe gehoben wurde, um dann in die Tiefe zu sinken. Dann ließ der zweite Vogel seinen Felsbrocken fallen und er schlug direkt auf die Kabine und zertrümmerte das Schiffsdeck und das Steuer.
Wir alle fielen ins Meer und kämpften um unser Leben. Ich umklammerte eine Schiffsplanke und Wellen schleuderten mich auf eine Insel zu. Und während meine Schiffsplanke in den Wellen zerschmettert wurde, schwamm ich an den Strand und rettete mich.
So manchen Schiffsbruch habe ich nun überstanden, dachte ich bei mir. Dann werde ich diesen auch überstehen. Und ich versprach mir erneut: Sollte ich das hier alles überstehen, wird das mein letztes Abenteuer sein.
Die Insel war sehr schön, üppige Bäume mit dicken Früchten wuchsen hier. Helle Bäche hatten sprudelndes Wasser, es duftete nach Blumen und Möwen flogen durch die Luft. Es gab auch Vögel, die ich nie zuvor gesehen hatte, und kleine Affen kletterten auf die Bäume.
Ich sah auch große Schildkröten und grüne Eidechsen, und Echsen, die fliegen konnten und große Blumen in violetten Farben. Müde suchte ich mir einen Ruheplatz und schlief dort bis zum nächsten Morgen. Dann pflückte ich mir Früchte und aß sie. Danach wusch ich mich in einem Bach und trank Wasser aus einem Brunnen.
Am Brunnen aber traf ich einen alten Mann. Ich freute mich, ihn zu sehen, denn es ist besser, zu zweit zu sein, als allein. Ich grüßte ihn und wünschte ihm Frieden. Doch er antwortete nicht. Da fragte ich ihn: Mein Oheim, warum sitzt du hier?
Doch statt zu antworten, stöhnte er nur und machte mir ein Zeichen, als wolle er mir sagen: Nimm mich auf deine Schulter und trage mich dort hinüber. Da dachte ich: Vielleicht ist er krank und hat seine Sprache verloren. So nahm ich ihn auf meine Schulter und trug ihn an die Stelle, die er sich gewünscht hatte.

Dann sagte ich zu ihm: So, Väterchen, jetzt kannst du von deinem gehorsamen Esel absteigen, und lachte dabei. Er aber antwortete nicht, sondern knurrte nur und umklammerte mich mit seinen Beinen. Erst jetzt sah ich, dass seine Beine schwarz und rau wie die Beine eines Büffels waren.
Ich erschrak und versuchte, ihn abzuwerfen, aber er umklammerte meinen Hals ganz fest. Ich bekam keine Luft mehr und wurde fast ohnmächtig. Er aber stieg immer noch nicht ab, sondern umklammerte meinen Körper mit seinen Beinen und trommelte mit seinen Fersen gegen meinen Rücken.
Ich wehrte mich, aber er umklammerte mich weiter hin und ich war hilflos wie ein Kind. Au, was machst du?, rief ich verzweifelt. Ich habe dich für einen alten Greis gehalten, aber nun zeigst du, dass du ein Ringkämpfer bist. Rede doch mit mir und sag mir, was du von mir willst. Ich bin doch nicht dein Esel, auf dem du reiten kannst, so lange du willst.
Aber er stieg nicht ab, sondern zwang mich weiterhin durch Tritte, ihn herum zu tragen. Und wenn ich nicht gehorchte, trommelten seinen Füße so sehr, dass ich es kaum aushalten konnte. So war ich sein Sklave geworden und trug ihn über die Insel, bis es Abend wurde. Und auch dann ließ er mich nicht los. Auch als ich mich schlafen legen wollte, blieb er auf mir sitzen, und ich musste in dieser unbequemen Lage schlafen.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, saß er noch immer auf mir und forderte von mir, weiter getragen zu werden. Da bereute ich es zutiefst, dass ich mit ihm Mitleid gehabt hatte, denn jetzt musste ich dieses unwürdige Schicksal erleiden. Ich musste alles tun, was er von mir verlangte.
Eines Tages kam ich mit dem Reiter auf mir an eine Stelle, an der es Kürbisse gab. Ich pflückte einen großen trocknen Kürbis, und quetschte Trauben von einem Rebstock dort hinein. Ich stellte den Kürbis in die Sonne und wartete, bis sich daraus Wein gebildet hatte. Den trank ich dann, und es wurde mir etwas leichter ums Herz.
Er aber sah sich an, was ich tat, ohne davon zu kosten. Eines Tages aber wurde er neugierig und machte mir ein Zeichen, als wolle er mich fragen, was es sei. Das ist ein Getränk, das tröstet und glücklich macht, erklärte ich.
Und weil ich selbst von dem Wein betrunken war, galoppierte ich mit dem Alten auf dem Rücken über die Insel, sang, torkelte und lachte. Da machte mir der Alte ein Zeichen, ihm auch den Wein zu reichen. Das tat ich.
Er trank von dem Getränk und war sehr angetan. Immer mehr trank er, und dann begann auch er zu grunzen und zu lachen. Dann trank er weiter, bis nichts mehr im Kürbis war, und nun lachte und klatschte er und der Wein stieg ihm wie Nebel in den Kopf.
Als ich merkte, wie er durch den Wein immer mehr das Bewusstsein verlor, riss ich seine Beine von meinem Nacken und warf ihn mit einem Ruck auf den Boden. Da lag er nun, aber seine Augen blitzten vor Wut. Er bemühte sich, wieder aufzusteigen, aber ich nahm einen Stein und schleuderte ihn mit aller Kraft auf ihn. Da blieb er regungslos liegen und war tot.
Erleichtert kehrte ich zur Küste zurück und hielt nach fremden Schiffen Ausschau. Allah meinte es noch einmal gut mit mir und schickte mir ein Schiff vorbei. Es warf seinen Anker vor der Insel, und die Reisenden stiegen aus. Ich lief ihnen, nackt wie ich war, entgegen, denn der Alte hatte bei seinen Satansritten all meine Kleider zerrissen.
Die Reisenden umstanden mich und ließen sich meine Geschichte erzählen. Dann sagten sie: Wir haben von diesem Mann gehört. Er wurde Scheich ael-Bahr oder auch der Alte vom Meer genannt. Niemand hat es bis jetzt geschafft, ihn loszuwerden. Sobald er seine Beine im Nacken hatte, musste er geritten werden, bis er umfiel. Anschließend fraß der Alte ihn auf, denn er war ein Kannibale, kannte viele Zaubereien und hatte unmenschliche Kraft. Freue dich, dass du ihm entkommen bist.
Dann luden sie mich auf ihr Schiff ein, und wir segelten Tage und Nächte. Schließlich kamen wir zu einem Ort, den man Affenstadt nannte. Diese Stadt bestand aus hohen Häusern und einem einzigen schmiedeeisernen Tor, von dem aus man in die Boote und aufs offene Meer gelangen konnte. In diesen Booten auf dem Meer verbringen die Bewohner des Ortes ihre Nächte, denn sie haben große Angst vor den riesengroßen Affenhorden, die nachts aus den Bergen kommen.
Als ich das hörte, war ich sehr unruhig. Ich erinnerte mich an mein Erlebnis mit den Menschenaffen. Doch ich erfuhr, dass diese Menschenaffen Tiere seien. Und weil ich mehr von den Tieren erfahren wollte, ging ich an Land.
In der Stadt gab es viel zu sehen. Darum verspätete ich mich. Als ich zum Hafen zurückkehrte, war das Schiff schon abgefahren. So ging ich in die Stadt zurück. Ich war sehr verwirrt. Da fragte mich einer von denen dunkelhäutige Menschen: Du scheinst in dieser Stadt ein Fremder zu sein."
"Ja", antwortete ich. "Ich bin soeben von meinem Schiff verlassen worden. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll." Komm mit auf mein Boot, antwortete der Fremde. "Wenn du die Nacht in der Stadt verbringst, bringen dich die Affen um."
So stieg ich mit ihm in sein Boot, und wir ruderten auf das Meer hinaus, und warfen nach einer Meile den Anker. Hier verbrachten wir die Nacht. Als es Tag wurde, ruderten wir in die Stadt zurück, und jeder ging seine Arbeit nach. So ging das jeden Tag. Immer kamen nachts die Affen in die Stadt, fraßen von den Früchten, und kehrten am Tag in die Berge zurück.
Eine erstaunliche Sache trug sich in einer Stadt zu, die ebenfalls auf dieser Insel lag. Eines Tages fragte mich einer, mit dem ich die Nacht auf dem Boot verbrachte: Oh Fremder, sage mir, was willst du hier tun? Wovon willst du leben? Willst du ein Handwerk ausüben? Über welche Kenntnisse verfügst du?"
Ich antwortete: "Bei Allah, ich weiß es selbst nicht. Ich kann alles und gar nichts. Ich bin Seefahrer und Kaufmann, Sattelmacher und Pferdezüchter. Doch ein Handwerk habe ich nicht erlernt. Aber vielleicht ergibt sich eine Aufgabe für mich."
Nun brachte mir der andere einen Sack, der mit etwas gefüllt war, das wie Baumwolle aussah. Gehe in die Stadt, und nimm diesen Sack mit. Fülle ihn mit Kieselsteinen, und macht dann das, was die Menschen in dieser Stadt auch tun. Vielleicht bekommst du genug Geld, um in deine Heimat zurückzukommen."
Ich ging an den Strand und füllte meinen Sack mit Kieselsteinen. Dann zog ich in die Stadt. Ich war nicht lange gegangen, da begegneten mir anderer Menschen, die ebenfalls einen Sack mit Steinen trugen. Nehmt diesem Mann mit euch", sagte der Fremde zu den anderen. "Dieser Mann ist fremd hier. Zeigt ihm, wie er sich durch das Sammeln sein Geld verdienen kann. Allah wird es euch danken.
Und sie nahmen mich mit. Wir kamen in ein weites Tal. Es war voller hoher Bäume. Unter diesen Bäumen hockten viele Affen. Als sie uns sahen, sprangen sie auf flohen auf die Bäume. Die anderen nahmen nun Steine aus ihrem Sack, und bewarfen die Affen damit. Jetzt rissen die Affen Früchte von den Bäumen und schleuderten sie auf uns.
Ich schaute mir die Früchte genau an. Es waren Kokosnüsse. Nun suchte ich mir einen Baum aus, der besonders große Früchte hatte. Ich warf mit meinen Steinen nach den Affen, und sie schleuderten mir die großen Kokosnüsse entgegen. Auf diese Weise ergatterte ich so viele Nüsse, dass ich sie kaum tragen konnte.
Als wir in der Dämmerung wieder in unserer Stadt an kamen, ging ich zu dem freundlichen Mann, der mir geholfen hatte, schenkte ihm alle meine Nüsse und bedanke mich für seine Hilfe. Doch der Mann wollte meine Nüsse nicht haben. Er riet mir ein Geschäft zu eröffnen und meine Kokosnüsse zu verkaufen.
Das was du heute getan hast, solltest du jeden Tag tun", sagte er. Dann hast du schnell dein Geld für deine Reise zusammen." Ich tat, was mir der Mann geraten hatte, sammelte jeden Tag Nüsse, verkaufte einen Teil und legte mir Vorräte an. Ich lebte sehr sparsam, und so konnte ich eine schöne Summe Geld an die Seite legen.
Nach einiger Zeit war ich sehr wohlhabend geworden, und ich gewöhnte mich an ein schönes und gemütliches Leben.
Als ich eines Tages an Strand stand, sah ich wie ein großes Schiff auf unsere Küste zu steuerte. Es waren eine Gruppe Kaufleute, die unterwegs waren. Für mich war das eine Gelegenheit, mit ihnen mit zu reisen.
So danke ich meinen Freunden für ihre Hilfe und verabschiedete mich von ihnen. Wir lichteten die Anker noch am selben Tag, und fuhren davon. Die Affenstadt versank am Horizont.
Überall wo wir angelegten, handelte ich mit meinen Kokosnüssen und ich erzielte einen hohen Gewinn. Ich lernte auf dieser Reise vieles Neue kennen, Gewürznelken, Zimt und auch scharfen Pfeffer. Alle diese Sachen kaufte ich für meine Heimat. Wir fuhren auch weiter zu der Insel ael-Usirat, wo ich wertvolle Aloe-Hölzer kaufte.
Diese Insel hat mir aber nicht gefallen. Die Menschen mochten keine Fremden und sie kannten Allah nicht. So fuhren wir schnell weiter zur Perlenküste, und da fand ich die Grotte mit den Muscheln wieder.
Wir holten viele Schätze heraus, und alle, die mit mir gereist waren, wurden reich. Diesen Strand sah ich später nie wieder. Reich an Perlen, Geld und Gewürzen kehrten wir nach Bassora und nach Bagdad zurück. Ich lud alle meine Freunde ein und gab ein großes Fest. Es gab viel zu essen und schöne Geschenke, und ich danke Allah für seinen wunderbaren Wege.
Dies, liebe Freunde, ist die Geschichte meiner fünften Reise. Lasst uns nun zu Abend essen. Morgen aber kommt wieder, damit ich euch von meiner sechsten Reise erzählen kann.
Und wieder ging Sindbad der Lastträger mit 100 Dinaren nach Hause. Am nächsten Tag aber kehrte er zurück und ließ sich das Abenteuer der sechsten Reise von Sindbad dem Seefahrer erzählen.
Die sechsten Reise Sindbad des Seefahrers
Dann meine Brüder ergab sich meine sechsten Reise wie von selbst. Eigentlich wollte ich zu Hause bleiben, denn ich hatte genug Abenteuer und Gefahren erlebt. Dann aber kamen Nachbarn zu mir, die einer Handelsreise machen wollten. Sie brauchten meinen Rat, und ich plante die Reise mit ihnen. Einiges war schwer zu erklären, und so fand ich es am einfachsten, einfach mitzureisen.
Ich war selbst überrascht, als ich mich an Bord eines Schiffes wieder fand. Aber ich lachte und sprach: Dann ist es wohl so - mein Leben steht unter dem Stern des Meeres, und so kommt es, dass ich mich immer auf einem Meer wieder finden."
Erst als wir losgefahren waren und alles die Unendlichkeit des Meeres umgab, fiel mir ein, dass mein Leben auch unter dem Stern des Schiffbruches steht. Gedanken verloren stand ich da und sah den Delfinen zu. Dieses Mal schien alles ruhig und gefahrlos zu sein. Die Wellen waren sanft, und der Wind brachte das Schiff voran.
Wir waren alle guter Dinge, und ich war schnell der Überzeugung, dass diese Reise meine schönste Reise werden würde. Kein Riesenfisch, kein Riesenvogel und keine Kannibalen würden auf mich warten.
Oh Freunde, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man ganz zufrieden erst? Alles lief gut. Wir waren erfolgreich im Handeln, es gab keinen Sturm und keinen Streit, ja, es war fast ein wenig langweilig.
Doch kaum hatte ich meinen Gedanken zu Ende gedacht, da kam ganz unvermutet ein Orkan und wirbelte unser Schiff hin und her. Oh Sindbad, hast du jemals und so einen Orkan erlebt?, fragte mich der Kapitän. "Und weißt du überhaupt, wo wir im Moment sind?"
Und ich antwortete: Oh Kapitän, wenn du den Kurs nicht kennst, wie soll ich dann wissen, wo wir sind. Wir treiben wohl Richtung Indien, aber der Himmel und das Meer erscheinen mir fremd."
Wir kämpften weiter gegen den Sturm. Die Segel zerrissen und der Mast knickte. Wir sind vom Kurs abgetrieben, rief der Kapitän dann nach Tagen verzweifelt. Unser Schiff ist ein Wrack und kann sich nur mühsam über Wasser halten. Uns bleibt nicht anderes, als zu beten, Freunde.
Und so beteten wir inbrünstig zu Allah. In seiner Verzweifelung kletterte der Kapitän, der eigentlich ein älterer Mann war, selbst auf den Mast und spähte in alle Richtungen. Doch es war kein Land in Sicht.
Als er wieder an Deck war, brach auch der letzte Mast. Unser Schiff war ein Spielball für die Wellen. Wild wurde es hin und her getrieben. Das Ruder wurde zertrümmert. Dann gingen die ersten über Bord. Es wurden mehr und mehr. Der Himmel und die See brausten.
Schließlich trieb der Sturm das Schiff gegen einen Felsen, wo es zerschmetterte. Die meisten ertranken. Darunter war auch mein Freund und Nachbar, wegen dem ich die Reise überhaupt begonnen hatte.
Einige wurden zwischen den Felsen hin und her getrieben und schließlich an Land gespült. Unter den wenigen, die überlebten, war auch ich. Ich war verletzt und zu Tode erschöpft. Mit uns waren einige Kisten mit Waren an Land gespült worden. Waren von unzähligem Wert waren es.
Als meine Gefährten die vielen kostbaren Waren sahen, gerieten sie außer sich vor Erschöpfung und Erregung. So ein Zustand ist schwer zu beschreiben, die Menschen wirken wahnsinnig auf jemanden, der so etwas noch nie gesehen hat.
Ich hatte schon viele Schiffsbrüchige gesehen, und ich warnte sie, sich nicht mit diesen Gütern zu beladen. Niemand konnte schließlich wissen, was uns noch alles bevor stand. Zuerst stritten meine Gefährten mit mir, dann aber vertrauten sie mir und ließen mich die Führung übernehmen.
So begannen wir, die Gegend zu erkunden. Wir fanden nur wenig Nahrung in dieser kargen Gegend, und meine Freunde warfen schnell ihre Lasten wieder ab, die sie in ihrer ersten Gier mitgenommen hatten. Sie ermüdeten noch schneller als ich und waren im Nu erschöpft. Nachdem wir eine Weile gegangen waren, gerieten wir an einen Fluss. Er glitzerte wie ein Edelstein in der Sonne. Wir schauten uns das Flussbett genauer an und fanden wunderschöne Edelsteine, Rubine, Perlen, Mondsteine und Saphire. Eine Handvoll von diesen Steinen machte uns reicher als alle Waren am Strand.
Meine Freunde hatten wieder nichts anderes zu tun, als sich die Taschen voll zu stopfen. Sie beschwerten ihre Taschen und Turbane, ihre Kleider und Hosen. Ich lachte und sagte: Ihr habgierigen Kamele, ihr werdet auf diese Weise alle in diesem unbekannten Land umkommen. Und ich steckte mir nur wenige Steine in meine Taschen.
Noch wusste ich nicht, dass ich schon bald mit meiner Behauptung Recht haben sollte. Wir liefen weiter und kamen in eine Gegend, die mit rohem Ambra überlagert war. Bis zur Meeresküste erstreckte es sich, und zog sich sogar bis in das Meer hinein.
Tiere tauchten aus dem Meer auf, verschlangen es und tauchten wieder in die Tiefe zurück. Meine Freunde stürzten sich auf diese Ambraquelle und beluden sich damit. Ich aber folgte dem Ambrafluss bis zur Quelle. Hier sah ich, dass das Ambra in einem kleinen Rinnsal bis zum Meer floss.
Dieses Rinnsal floss in einem verkrusteten Flussbett, das wie eine Mauer aussah. Wenn die Sonne auf die Quelle schien, duftete sie wie Moschus. Jetzt erkannte ich auch, dass die Quelle des Ambras keine wirkliche Quelle war, sondern unterirdisch weiter floss und wahrscheinlich hoch in den Bergen liegen musste, an einem Ort, den vielleicht noch nie ein Mensch erstiegen hatte.
Hier wuchs auch wunderschönes Aloeholz. Spöttisch und verbittert zugleich sagte ich zu meinen Freunden: Wollt ihr nicht auch noch Bäume fällen und das Holz mit euch schleppen? Sie murrten verärgert. Aber als die Sonne unbarmherzig auf uns hernieder schien, und wir alle hungrig waren, warfen die ersten ihre Lasten wieder ab. Edelsteine und Perlen lagen nun im Sand und es duftete nach Ambra.
Einige von uns waren krank geworden. Es war schwer, sie zu pflegen, weil es nur wenig Nahrung und Wasser gab. Auch Heilkräuter wuchsen hier nicht. So kam es, dass die ersten um uns herum starben.
Nach und nach hörte der Streit unter uns auf. Jeder war froh, wenn er das nackte Leben retten konnte. Ich aber sagte mir: Warum ärgere ich mich so über ihre Gier nach Gewinn. Ich bin doch früher auch so gewesen. Und im Grunde genommen war ich es immer noch.
Da wurde ich wirklich mitleidig und nahm mir vor, den anderen zu helfen, in der Hoffnung, dass wir alle gut nach Hause kämen. Aber einer nach dem anderen starb, und ich konnte es nicht ändern. Schließlich war ich ganz alleine übrig.
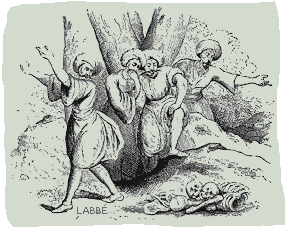
Schweren Herzens begrub ich meine Freunde, dann schlug ich mich allein weiter. Ich machte mir unterwegs bittere Vorwürfe, dass ich diese sechste Reise angetreten hatte. Was hätte ich zu Hause in Bagdad ein friedliches Leben haben können! Ich hatte so viel Geld, dass ich bis ans Ende meiner Tage damit auskommen konnte.
So war und blieb ich mir selbst ein Rätsel. Ich wanderte einsam weiter, bis ich wieder am Ufer des Flusses stand. Hier fand ich Früchte und auch Fische, um meinen Hunger zu stillen. Doch die Einsamkeit um mich herum machte mir Angst, und ich konnte nicht weiter gehen.
Da schickte mir Allah einen Gedanken, der mir weiterhalf: Wenn der Fluss ein Ende hatte, so musste er auch einen Anfang haben. Und vielleicht fand ich hier Menschen, die mir weiter helfen konnten. Ich kam auf die Idee, mir ein Floß zu bauen. Wenn ich damit die Strömung entlang fuhr, konnte ich gerettet werden, wenn ich im Fluss sterben würde, starb ich eben. Das war nicht zu ändern.
So sammelte ich viele Aloehölzer und band sie mit Tauen aneinander, die ich aus Kokospalmen geflochten hatte. Ich knüpfte es so fest, dass es wie genagelt aussah. Das Floß war ein wenig schmaler als der Fluss. Ich sammelte jetzt die schönsten Edelsteine, Perlen und reinen und wilden Ambra ein und suchte mir ein Holz, das ich als Ruder benutzen konnte.
Dann stieg ich in mein Floß und die Fahrt begann. Wir trieben an Tieren und Palmen, an Wäldern und einsamen Landschaften vorbei. Zuletzt kam ich an eine Stelle, in der der Fluss im Gebirge verschwand.
Klopfenden Herzens trieb ich mit meinem Floß auf ein schwarzes Loch zu. Weiter und weiter trieb mich die Strömung dem unterirdischen Bett zu. Ich geriet in einen Stollen. Die Decke war sehr niedrig und mein Floß stieß überall an. Da saß ich in der Falle und konnte nicht mehr umkehren.
Verzweifelung überkam mich. In meiner Not legte ich mich so flach es möglich war auf das Floß und zog mein Ruder ein. Rechts und links stieß ich mich mit meinen Händen von den Felsen ab. Das war sehr anstrengend. Meine Hände begannen, zu bluten. Eiskaltes Wasser tropfte von der Decke in meinen Nacken. Das Wasser um mich herum schäumte, und die Dunkelheit hüllte mich ein, wie ein Ungeheuer.
Endlich aber spürte ich, wie mich die Strömung wieder fort riss und mein Floß erneut vorangetrieben wurde. Die unterirdische Fahrt ging weiter. Sie führte mich durch Stollen, die mal weiter und mal enger waren. Irgendwann hatte ich keine Kraft mehr und sank in einen tiefen Schlaf.
Ich schief so fest, dass ich beim Erwachen nicht mehr wusste, wie lange ich geschlafen hatte. Aber jetzt war es taghell um mich herum und die Sonne erwartete mich. Ich war in der Mitte des breiten Flusses angekommen.
Am Ufer des Flusses standen Menschen, die aussahen wie Inder. Sie betrachteten mich, und als ich auf sie zu ruderte, sprachen sie mich in ihrer fremden Sprache an. Das alles war für mich wie ein Traum. Nun kam einer auf mich zu, der arabisch sprach. Friede sei mit dir, sagte er. Noch nie ist jemand auf diesem Weg zu uns gekommen.
Friede und der Segen Allahs sei auch mit euch, sagte ich. Bitte sagt mir, wer ihr seid und in welchem Land ich gelandet bin. Wir sind nette Menschen, Siedler und Bauern. Wir waren hier auf unseren Feldern, als wir dein Floß sahen. Und dann sahen wir dich, der du darauf selig schliefst, und so wollten wir dich nicht wecken. Aber erzähle uns, wie du hierhin gekommen bist.
Ich erzähle euch, was ihr wollt, sagte ich. Doch bitte gebt mir erst zu essen. Ich sterbe vor Hunger. Da lief der Fremde fort und brachte mir etwas zu Essen. Ich aß mich satt, und als mein Magen gefüllt war, fühlte ich mich wie neugeboren. Ich dankte Allah, dem Allmächtigen, für seine Rettung.
Und als ich mich ausgeruht hatte, nahmen sie mein Floß und meine Ladung und mich auf einen großen Ochsenkarren und brachten mich zum König. Ich erfuhr jetzt, dass ich im Lande Sarandib gestrandet war, das man auch Ceylon nennt.
Der König hieß mich willkommen und ließ den Mann kommen, der arabisch sprach. Er bat mich, von mir zu erzählen, und ich berichtete über meine Abenteuer. Dann holte ich Edelsteine, Ambra und Aloe und legte es vor den König. Er behandelte mich mit großer Würde und ließ mir eine Wohnung in der Nähe seines Palastes zukommen. Ich lernte die Großen des Landes kennen und fühlte mich hier sehr wohl.
Sarandib ist eine große Insel. Sie liegt in der Nähe der Tag- und Nachtgleichen, hier haben Tag und Nacht hier genau zwölf Stunden. Sie ist dreißig Meilen breit und achtzig Meilen lang, und ist umgeben von Bergen und Tälern.
Der höchste Berg ist von überall zu sehen. In seinem Inneren verbergen sich Rubine. Viele Gewürze und kostbare Gesteine gibt es hier. Diamanten findet man im Wasser, Perlen in den Tälern. Es gibt auch Saphire und Mondsteine auf dieser Insel.
Eines Tages kletterte ich mit einigen Begleitern den Gipfel des Berges hinauf. Es war sehr gefährlich, doch als wir oben angekommen waren, hatten wir einen wunderschönen Ausblick über die Täler, Wälder und Ströme.
Diese Insel ist voller Wunder und Rätsel, wie das große Indien. Es gibt Säbelzahntiger und Elefanten, rote Affen und weiße Büffel, Schlangen, schöne Vögel und wundervolle Fische. Alle Menschen fragten mich nach meiner Heimat und ich beschrieb alles über den Kalifen Harun al Raschid und seine große Weisheit, das Land so gut zu regieren. Ich dagegen lernte die Sitten und Gebräuche des neuen Landes kennen und erwarb dadurch ein großes Wissen.
Der König wollte mehr über die Regierung des Kalifen und die Verwaltung unseres Landes kennen, und ich beschrieb ihm viele verschiedene Gesetze und Grundsätze. Das imponierte dem König sehr. Der Kalif muss in der Tat sehr weise sein, sagte er. Was du über ihn erzählst, hört sich sehr liebenwert an.
Darüber freute ich mich sehr. Ich erhoffte mir auch von meinen Erzählungen, dass man mich auf ein Schiff zurückkehren ließ, damit ich meine Heimat wieder sehen konnte. Tatsächlich ließ der König ein wundervolles großes Schiff erbauen. Als es dann aber fertig war, sagte er zu mir: Oh Sindbad, ich lasse dich nur so ungern gehen. Du bist mir so eine liebenswerte Gesellschaft gewesen.
Aber ich lasse dich frei entscheiden, denn du bist dein eigener Herr. Doch bedenke, dass ich dich so gerne an meiner Seite habe und deinen guten Rat brauche. Ich verneigte mich vor ihm.
O Herr und König, sprach ich zu ihm. Ich weiß eure Freundschaft zu schätzen und habe dieses Land und natürlich auch euch sehr lieb gewonnen. Doch meine Zeit verrinnt, ich werde älter und älter und es überkommt mich der Wunsch, meine Heimat wieder zu sehen. Mein Herz sehnt sich nach all den Abenteuern nach Ruhe und Frieden.
Und der König nickte und hatte Verständnis für mich. Zum Abschied beschenkte er mich mit Schätzen aus seiner Schatzkammer und gab mir auch ein wunderschönes Geschenk für den Kalifen Harun el Raschid mit.
Außerdem ließ er ihm ein Schreiben überbringen. In hellblauer Tinte war es auf dünne Haut geschrieben. Der König ließ ihm seinen Frieden und seine Anerkennung zuteil werden und bat ihn in aller Freundschaft, das Geschenk anzunehmen.
Das Geschenk bestand aus einem Becher reinen Rubins, der mit wunderschönen Perlen verziert war. Außerdem ließ er ihm ein Bett überbringen, das aus der Haut einer Schlange bestand. Diese Schlangenhaut war in der Lage, Krankheiten zu heilen. Zu dem Geschenk gehörten auch kostbare Edelsteine und indische Aloe.
Wir stachen in See. Die roten Segel trotzten dem Wind. Ohne Zwischenfälle erreichten wir Bagdad. Ich machte mich sofort auf den Weg zum großen Kalifen, legte ihm die Geschenke zu Füßen und überreichte ihm den Brief.
Der Kalif konnte kaum glauben, was er dort las. Ist das alles wahr?, fragte er mich. Alles ist wahr, sagte ich. Er schätzt euch und verehrt euch, all diese Geschenke hat er euch überbringen lassen. Erzähle mir von dem Land, bat der Kalif.
Und ich erzählte von den Elefanten und von den Zinnen aus Edelstein. Ich berichtete von den Staatsumzügen, bei denen ein Thron auf einen Elefanten gestellt wird, auf dem sich der König niederlassen muss. Ich erzählte auch, dass ein Mann dem Umzug voraus geht, der einen Spieß trägt.
Und hinter ihm reiten viele Gefolgsleute auf edlen schnellen Pferden, und die Pferde sind in Goldbrokat und Seide gekleidet. Auch reitet ein Mann dem Zug voraus, der den König ankündigt.
Da rief der große Kalif: Wie beneidenswert er ist. Und er wusste nicht, dass auch der König von Sarandib diese Worte über den großen Kalifen gesprochen hatte.
Dann erzählte ich allen, was sich auf der Reise zugetragen hatte. Und der Kalif ließ seine Schreiber meinen Bericht aufschreiben und ließ ihn zusammen mit den Edelsteinen in seiner Schatzkammer aufbewahren.
Dann ging ich in mein Stadtviertel zurück und betrat mein Haus. Dort verteilte ich Geschenke an meine Freunde und feierte ein großes Fest mit ihnen. Ja, meine Freunde, das ist die Geschichte meiner sechsten Reise. Morgen werde ich euch die Geschichte meiner siebten und letzten Reise erzählen, so Allah es will.
Und er ließ Sindbad dem Lastträger hundert Dinare reichen. Und als das Abendessen gegessen war, ging jeder seiner Wege. Am nächsten Morgen aber kam Sindbad der Lastträger wieder. Sindbad der Seefahrer wartete schon auf ihn. Sie aßen zusammen, und dann begann Sindbad der Seefahrer mit seiner Geschichte.
Die siebte Geschichte Sindbad des Seefahrers
Und dann, Freunde, wagte ich mich noch einmal hinaus auf die See. Nach all den Schiffsbrüchen und Todesängsten wollte ich einmal eine schöne Reise, eine Reise des Friedens machen, um diese Reisen als angenehme Erinnerungen für immer abzuschließen.
Aber Freunde, heute weiß ich, dass dieser Gedanke nur eine Selbsttäuschung war. Ich wollte mir nicht eingestehen, dass mich mein Leben zu langweilen begann, und mich die Lust auf ein Abenteuer, aber auch die Gier nach guten Geschäften erneut gepackt hatte.
So ging ich auf ein Schiff. Bei gutem Wind erreichten wir die Stadt Maedinat aes Sim. Es war eine interessante Stadt, und wir waren fröhlichen Herzens, als wir weiter segelten. Dann allerdings kam ein heftiger Wind auf, und ein Gewitter prasselte auf uns hernieder.
Wir wurden hin und her gerissen. Als wir versuchten, den Anker zu werfen, riss die Ankerkette und wir wurden ein Spielball des Meeres. Lange Zeit trieben wir über das Meer und verloren jede Orientierung.
Dann aber setzten sich der Kapitän, alle alten erfahrene Matrosen und der Steuermann zusammen und berieten, wo wir uns befinden könnten. Dann sprachen sie zu uns: Nun endlich wissen wir, wo wir sind. Nach langer Überlegung haben wir es endlich herausgefunden.
Da freuten wir uns. Wie schön, Kapitän, sagte einer der Reisenden. Doch da wurde der Kapitän sehr wütend. Er riss seinen Turban vom Kopf und trampelte auf ihm herum.
Nein, nein, nein!, schrie er. Das ist überhaupt nicht schön. Im Gegenteil! Es ist so schrecklich, wie es nicht schrecklicher sein kann. Dieses verdammte Meer nämlich, über das wir fahren, wird das Meer der Königsgräber genannt.
Hier in der Mitte befindet sich das Grab des Königs Salomo, der Sohn Davis. Gepriesen ist zwar sein Name, aber verflucht sei das Meer. Es wimmelt hier von Fischen, die so groß sind, dass sie Menschen und sogar ein ganzes Schiff verschlingen können.
In der Tiefe wimmelt es außerdem von Seeschlangen. Das Verfluchteste aber sind die verfluchten Wirbelstürme, die so verflucht sind, dass man ihnen nicht entrinnen kann. Darum sage ich bei Satan: Verflucht noch mal.
Da sagte ich: Du brauchst nicht gleich so zu fluchen. Wir haben doch erst einen normalen Sturm, aber keinen Wirbelsturm. Warte ab!, rief der Kapitän. Sie fangen immer so an. Aber es ist auch gar kein Fisch oder eine Schlange zu sehen, fuhr ich fort. Natürlich nicht, brüllte der Kapitän. Sonst wärst du ja auch schon tot.
Ich konnte die ganze Aufregung nicht verstehen und sprach zu den anderen Reisenden: Dieser Kapitän ist etwas aufgeregt. Verzweifelt also nicht und gebt die Hoffnung nicht auf. Das machte den Kapitän sehr ärgerlich. Glaubt, was ihr wollt, rief er. Aber wir sind im schrecklichsten Meer am schrecklichsten Ort der Welt. Nun kommt ein Sturm auf und wirbelt uns herum. Aber hofft ruhig weiter, es kann ja nicht schaden.
Kaum hatte er das gesagt, wurde unser Schiff aus dem Wasser empor gehoben und wieder fallen gelassen. Wir schrieen alle laut. Dann beteten wir zu Allah, unsere sterbenden Seelen zu sich zu nehmen.
Jetzt plötzlich hörten wir einen Furcht erregenden Schrei. Er kam aus der Tiefe des Meeres. Und dann tauchte vor uns ein Fisch auf, der war so groß wie ein Berg. Neben ihm erschien nun ein zweiter Fisch, und der war das größte Wesen, das ich jemals in meinem Leben gesehen hatte. Neben ihm tauchte noch ein dritter auf, und der war größer als alle beide zusammen.

Alle drei umkreisten das Schiff. Und dann tat der riesengrößte Fisch sein Maul auf, um uns alle zu verschlingen. Wir schauten in sein Maul, das so groß wie ein Stadttor war. Bevor uns aber der Fisch verschlingen konnte, griff der Wirbelsturm nach dem Schiff. Er hob es empor und schleuderte es auf ein Riff.
Hier legte es sich auf die Seite und spülte mich über Bord. Das Schiff wurde aber erneut ins Meer gespült. Niemals erfuhr ich später, was aus meinen Freunden geworden war. Ich aber wurde von den Wellen an Land gespült.
Schiffsbrüchig lag ich am Strand und fühlte mich sehr elend. Oh Sindbad, sprach ich zu mir. Nur weil du auf deine Gier nach Reichtum nicht verzichten kannst, gerätst du immer wieder in so eine schlimme Lage. Erst wenn du dich wirklich änderst, wirst du von deinem Leiden befreit werden.
Immer aber versprachst du, dich zu ändern, aber du tatest es doch nicht. So musst du nun alles ertragen, was Allah für dich an Prüfungen bestimmt hat. Du hast nur die Wahl, dein Schicksal zu ertragen oder für immer auf deine Gier zu verzichten.
Ich erkenne, dass ich falsch gehandelt habe, und dass all meine Situationen als Schiffsbrüchiger Prüfungen Allahs waren, um mich auf den rechten Weg zu bringen. Es tut mir wirklich Leid, dass ich so gehandelt habe, und ich werde mein Fernweh durch Weisheit, Güte und Gelassenheit zu überwinden wissen. Und ich will in Zukunft ein bescheidenes Leben führen und Allah im Himmel lieben und danken, versprach ich inbrünstig.
Zwei Tage lebte ich in einem verödeten Gebiet, dann gelangte ich endlich an einen Fluss, der eine starke Strömung hatte. Da erinnerte ich mich an den Fluss in Sarandib, der mir das Leben rettete, und ich beschloss auch dieses mal, mir ein Floß zu bauen.
Wieder sammelte ich Holz von Bäumen, wunderbares Sandelholz, das es heute gar nicht mehr gibt, und flocht mir Seile aus Schlingpflanzen. Dann schob ich mein Floß in den Fluss. Lange Zeit plätscherte ich dahin. Die Landschaft zog an mir vorbei. Sie war fruchtbar und schön.
Dann aber hörte ich ein Tosen und musste feststellen, dass ich direkt auf einen Wasserfall zu steuerte. Das Land vor mir senkte sich, und ich stellte fest, dass ich auf einem Hochplateau war. Ich versuchte mein Floß anzuhalten, doch es war nicht mehr möglich. Die Strömung trieb es weiter auf die Tiefe zu.
Schnell nahm ich meinen Turban und band mich in fliehender Hast an dem Floß fest. So stürzten wir gemeinsam in die Tiefe. Ich hing an dem Floß und wurde im Wasser hin und her geschleudert. Wie Peitschenhiebe fühlte sich das an.
Als ich im Wasser versank, kam es mir vor, als versinke ich in eine Meerestiefe. Und dann wieder überschlug sich das Floß und zog mich mit sich. Halb ertrunken, halb erschlagen wurde ich wieder an die Oberfläche gespült. Ich öffnete die Augen und sah, dass das Floß noch heile geblieben war.
Unverletzt, aber erschöpft kletterte ich wieder hinauf und dankte Allah für seine Gnade. Dann aber ließ ich mich weiter treibe. Das Floß glitt durch die Landschaft. Jetzt traf ich auch auf Menschen. Sie warfen mir Seile zu, damit ich mich daran festhalten konnte, aber ich war zu schwach dazu.
Dann warfen sie ein Netz über das Floß und zogen mich an Land. Ich war nicht in der Lage, mich zu bewegen, fiel einfach um, als wenn ich tot wäre. Die Fremden stützten mich und brachten mich wieder auf die Beine.
Dann trat ein alter Mann aus der Menge der Fremden heraus. Er war Scheich und begrüßte mich und hieß mich willkommen. Dann ließ er mir ein Bad anrichten, kleidete mich neu ein und lud mich zum Essen ein. Hier erzählte ich ihm meine Geschichte.
Der alte Mann hatte eine hübsche junge Tochter, die mir gut gefiel. Sie war schön wie das Mondlicht über den Wäldern und wie es Sitte in dem Land ist, beteiligte sie sich eine Weile an der Unterhaltung, bis sie sich mit ihren Dienerinnen in ihre Frauengemächer zurückzog.
Ich sah ihr nach. Das bemerkte mein Gastgeber, und er sagte, seine Tochter gliche seiner Frau, die vor einigen Jahren verstorben sei. Sie sei die schönste Frau des ganzen Landes gewesen.
Sie ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe, sagte ich. Und sie wird genauso reich an Klugheit sein. Wir tranken zusammen Scherbet und machten uns Gedanken über das Leben und die Welt.
Ich blieb drei Tage im Haus des alten Mannes und seiner Tochter und hatte mich selten irgendwo wohler gefühlt. Am vierten Tag kam der Scheich zu mir und sprach: Nun komme mit mir, damit du deine Waren verkaufen kannst, die meine Diener die ganze Zeit über bewacht haben.
Ich war verwirrt. Welche Waren meinte der Mann? Er aber sagte: Mein Sohn, wundere dich nicht. Komm einfach mit auf den Markt. Dann wirst du sehen, was ich meine. Wenn dir einer für deine Waren einen guten Preis bietet, nimm ihn an, wenn dir der Preis aber zu niedrig erscheint, kannst du deine Waren weiterhin im Lagerhaus lagern lassen.
Aber ja, da will ich dir nicht widersprechen, oh mein Herr, sagte ich, aber ich wusste wirklich nicht, wovon er redete. Ich ging mit dem Scheich auf den Markt. Dort sah ich, wie sie mein Floß in alle Einzelteile zerlegt hatten und das Sandelholz zum Verkauf anboten.
Die Kaufleute eilten herbei und einer nach dem anderen bot einen guten Preis. Ich wartete, bis er eine Höhe von tausend Dinaren erreicht hatte. Willst du nicht annehmen?, fragte mich der Scheich verwundert. Das Geschäft liegt in deinen Händen, sagte ich.
Da sagte er: Dann biete ich zweitausend Dinare und kaufe dein Sandelholz selbst. In Ordnung, sagte ich. Es sei wie du willst. Die Kaufleute waren empört und gingen kopfschüttelnd davon.
Als der Scheich kam und mir elfhundert Dinare auszahlen wollte, freute ich mich zunächst über mein gutes Geschäft. Dann aber fielen mir meine guten Vorsätze wieder ein. Ich wollte doch nicht mehr Gut und Geld nachjagen, sondern das Leben an sich wichtig nehmen.
So sagte ich zu dem Scheich: Oh edler Freund, ich wusste gar nicht, dass meine Hölzer so edel waren. Ich baute mir das Floß, um mir das Leben zu retten. Ich wollte auch nicht als reicher Mann nach Hause kommen, sondern mich frei von Gier und Geld machen. Darum bitte ich dich, lieber Freund, lass mich dir dieses Sandelholz zum Dank schenken.
Er wollte aber mein Geschenk nicht annehmen, und ich wollte sein Geld nicht annehmen, und so ließen wir das Holz in Lagerhaus bringen und redeten nicht mehr davon. Aber ich blieb sein Gast und wohnte bei ihm. Dabei gewann ich seine Tochter von Tag zu Tag lieber. Groß war meine Angst, eines Tages von ihr Abschied nehmen zu müssen.
Eines Tages kam der alte Mann in mein Zimmer und begann zu sprechen: Ich habe eine Tochter, die ich liebe, wie nichts anderes auf der Welt. Manchmal denke ich natürlich an ihre Zukunft, was aus ihr werden soll, wenn sie eines Tages nicht mehr bei mir wohnt.
Wenn ich richtig gesehen habe, hast du sie lieb gewonnen. Das habe ich gemerkt. Umso mehr wundert es mich, dass du darüber nicht mit mir sprichst. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du ein Fremder bist oder ob du Angst hast, mir die Sonne meines Alters aus meinem Herzen zu nehmen, aber es verwundert mich. Darum bitte ich dich, sage, was dich bewegt.
Ich habe in meinem Leben viele Abenteuer erlebt, aber jetzt war ich wie ein Jüngling. Ich errötete und sagte nur mühsam: Ja, so ähnlich ist es wohl.
Da lächelte der alte Mann. Höre, sagte er. Du bist für mich wie ein Sohn. Wenn du also meine Tochter heiraten möchtest, so freue ich mich und gebe euch meinen Segen. Ich war zutiefst gerührt über diese Worte.
Nur eine Bitte haben ich, sagte der Mann. Ich bin ein alter Mann und habe nicht mehr lange zu leben. In der Zeit, wo ich aber noch lebe, möchte ich dich bitten, mit meiner Tochter hier bei mir zu bleiben. Sollte ich gestorben sein, kannst du gerne mit ihr in deine Heimat zurückkehren, wenn du möchtest, oder auch hier bleiben, ganz wie du willst.
Und damit du deine Verpflichtung nicht als Last empfindest, sollst du mein Geschäft erben und mein Haus soll dir genauso gehören, wie mir. Ich weiß, dass wir keinen Streit um den Besitz haben werden, denn ich habe dein Verhalten bei der Sache mit dem Sandelholz nicht vergessen.
Ich dankte ihm tausend Mal, lief dann zu seiner Tochter, schloss sie in die Arme und hielt um ihre Hand. Und bald darauf wurde unsere Hochzeit gefeiert. Es gab in diesem Land ebenfalls seltsame Bräuche, aber nicht der, dass man mit einem Menschen lebendig begraben wurde. Aber selbst wenn es das gegeben hätte, hätte es mich nicht davon abgehalten, diese wunderbare Frau zu heiraten.
Unser Leben war schön und zufrieden. Ich arbeitete im Geschäft meines Schwiegervaters, und führte es verantwortungsvoll, sodass wir ein gutes Einkommen hatten. Ich wurde sogar wegen meiner großen Erfahrung zum Vorsteher der Kaufmannschaft gewählt. Immer passte ich auf, niemanden zu schädigen und nicht an meine Gewinnsucht zu denken. Und gerade das führte zu großem Segen.
Je länger ich in dem Land wohnte und je besser ich die Bewohner kennen lernte, umso mehr wunderte ich mich über einige Dinge. Es gab Tage, an denen sich die Bewohner seltsam veränderten. An diesen Tagen kamen sie mit Vogelmasken auf die Straße, und aus ihren Schultern wuchsen Flügel. Mit diesen Schwingen gelang es ihnen, sich in die Lüfte zu erheben und als Vogelschwarm davon zu fliegen.
Mein Schwiegervater, der Scheich, zeigte sich überhaupt nicht verwundert, wenn so etwas geschah. Umso verwunderter fragte ich ihn, was das alles zu bedeuten hatte, doch er antwortete: Oh rede nicht davon. Ich will davon nichts wissen.
Da beschloss ich allein, dieses Geheimnis zu ergründen. Und als die Zeit kam, in der sich die Menschen verwandelten, ging ich zu einem Bekannten und sprach zu ihm: Nimm mich mit auf euren Flug. Das geht nicht, antwortete er.
Doch ich bedrängte ihn immer wieder. Dann endlich stimmte er zu. Ich redete mit niemandem darüber. Als es so weit war, nahm mich der Bekannte auf seinen Rücken, und ich flog mit ihm davon. Fast hatte ich das Gefühl, den Engeln Allahs nahe zu sein. Gelobt sei Allah, rief ich laut.
Doch kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen, da fuhr ein Feuer vom Himmel direkt zwischen uns. Um ein Haar hätte es uns erwischt. Die Fliegenden waren so wütend auf mich, dass sie sich auf mich stürzten, mich vom Rücken des Bekannten herunter rissen und mich hinunter warfen.
Es war ein Wunder, dass ich unverletzt blieb. Ich war in einen riesigen Heuhaufen gefallen. So erhob ich mich und versuchte, zurück zu wandern. Ich wanderte durch ein seltsames Gebiet, das mir anders als alles andere erschien, was ich bisher gesehen hatte.
Es war ein anders Licht hier, und hin und wieder bildete ich mir ein, Flöten zu hören. Fast erschien mir alles ein wenig unwirklich. Als ich an zwei riesigen Felsblöcken vorbei kam, traten zwei Jünglinge hinter den Felsblöcken hervor. Sie stützten sich auf zwei Wanderstöcke, die aus rotem Gold waren.
Allah sei mit euch, sprach ich. Wer seid ihr, und was tut ihr hier? Wir sind die Diener des Allerhöchsten, und wir wohnen hier im Gebirge, berichteten sie. Dann reichten sie mir ebenfalls einen Stab aus Gold und gingen weiter.
Ich war höchst verwundert und wanderte weiter, dabei dachte ich ununterbrochen an die schönen Jünglinge. Nun veränderte sich die Landschaft. Marmorblöcke lagen herum und die schroffen Felsen hatten tiefe Höhlen. Plötzlich kam aus einer der Höhlen ein schlangenartiges Untier hervor. Es hielt einen Menschen in seinem riesigen Rachen. Der zappelte und lebte noch. Verzweifelt schrie er um Hilfe.
Da nahm ich meinen goldenen Stab und schlug der Schlange auf den Kopf. Erschrocken spuckte sie den Menschen aus. Dann drehte sie sich zu mir um. Aber ich nahm meinen Stab und stieß ihn ihr ins Maul. Dann zog ich ihn wieder heraus und schlug ihr damit auf den Schädel.
Verwirrt drehte sie sich herum und floh in ihre Höhle zurück. Der Mann aber, dem ich das Leben gerettet hatte, war nur leicht verletzt. Er danke mir für seine Rettung und blieb danach bei mir.
Gemeinsam gingen wir weiter, bis wir auf eine Gruppe von Menschen trafen, mit denen wir mitgingen. Ich aber sah genauer hin und erkannte in der Gruppe den Bekannten, der mich auf seinen Rücken genommen hatte. Auch die anderen waren bei ihm.
Da sprach ich zu ihnen: Was in aller Welt ist in euch gefahren, mich zu nehmen und hinunter zu werfen. Ihr Wüteriche, ihr Fledermausbrut, ihr hättet mich umbringen können. Was habe ich getan, dass ihr mich so behandelt!
Da trat einer auf mich zu und sagte: Zähme deine Zunge! Nicht wir hätten dich umgebracht, du hast unser Leben leichtsinnig auf`s Spiel gesetzt. Was war in dich gefahren, als du auf dem Rücken Allah lobtest?
Was ist denn daran schlecht, den Höchsten und Allermächtigsten zu loben und zu preisen?, fraget ich verwundert. Wer das tut, ist des Todes, sagten sie. Aber ich lebe noch, wie ihr seht, erwiderte ich.
Nun sprach niemand mehr ein Wort. Das war mir sehr unheimlich. Ich sagte zu meinem Bekannten: Egal, was du getan hast, du kannst es wieder gut machen, wenn du mich zurück nach Hause bringst.
Ich kann es nur tun, wenn du mir versprichst, nie wieder den Namen Allahs auszusprechen, wenn du auf meinem Rücken sitzt, antwortete er. Das versprach ich ihm. Ich schenkte dem Mann, dem ich das Leben gerettet hatte, meinen goldenen Stab. Dann nahm ich Abschied.
Mein Bekannter nahm mich auf den Rücken und brachte mich zurück zu der Stadt, aus der ich kam. Weinend kam mir meine Frau entgegen gelaufen. Ihr Vater, der Scheich, war in der Zwischenzeit gestorben, und nun wusste sie nicht mehr, ob sie sich über mein Wiedersehen freuen oder um ihren Vater trauern sollte.
Zu mir sagte sie: Ich bitte dich, nie wieder mit den anderen auszuziehen. Was sie dort machen, ist das Werk des Teufels. Darum darf man auch in ihrem Beisein den Namen Allahs nicht erwähnen. Wie war es euch möglich, unter diesen Menschen zu leben?, fragte ich verwundert.
Mein Vater kam als junger Mann und Fremder in dieses Land, erzählte meine Frau. Lange Zeit sah er diese Flugkünste, aber er wusste nicht, dass sie etwas Böses waren, und die anderen verrieten es ihm nicht. Mein Vater bemerkte es irgendwann, aber er redete nicht mit ihnen darüber.
Es leben ja eigentlich freundliche Menschen hier, und das Fliegen kommt nur zu wenigen Zeiten über sie. Da mein Vater aber aus einem Land geflohen war, in dem ein böser Tyrann herrschte, blieb er hier.
Zuerst versuchte er, die Einwohner von den Taten abzubringen, aber sie wollten es nicht. So konnte er sich nur gegen sie schützen, weil Allah ihm gnädig war. Mein Vater zog sich immer mehr in sein Haus zurück, denn er war zu alt, um fort zu gehen. Aber er setzte sich dafür ein, dass andere Menschen, die an Allah glaubten, in unserer Stadt kamen und hier blieben. Doch es gelang ihnen niemals, die andere von ihrem Teufelswerk weg zu bekommen.
Ich will nicht länger hier bleiben, sagte ich. Dein Vater hat mir gesagt, ich sei nach seinem Tode frei, fort zu gehen, und so bitte ich dich, meine Liebe, mit mir nach Bagdad zurück zu kehren.
Wir verkauften Haus und Geschäft und stiegen auf ein Schiff. Dann fuhren wir in einer friedlichen Reise ohne Sturm und Schiffbruch nach Bagdad zurück. Wie staunten da meine Freunde, dass ich wieder da war. Ich gab allen Menschen zu Ehren ein großes Fest und verteilte den Besitz unter den Armen, wie ich es Allah versprochen hatte.
Meine Freunde konnten es nicht glauben, mich gesund wieder zu sehen. Ich war doch viele Jahre weg gewesen. Nun aber war ich als neuer Sindbad wieder heimgekehrt. Ich strebte nicht mehr nach Geld und Gier, ich lebte in Ruhe und Frieden und ließ Wärme und Freundlichkeit in mein Herz.
Dieses hier ist also die letzte Geschichte meiner Reise. Das heißt, genau genommen ist es die vorletzte Geschichte, denn die letzte Geschichte steht uns noch bevor. Es ist die Reise in Allahs Reich, wenn wir heimfahren zu ihm.
Du, Sindbad der Lastträger, verstehst, was für Umwege ich gehen musste, bis mir diese Weisheit zuteil wurde. Mein Haus und mein schöner Garten, die Tiere und Blumen sind dazu da, mein Herz friedlich zu stimmen.
Du siehst auch, wie viele Lasten ich zu tragen hatte, bis ich zu der Erkenntnis kam. Es muss nicht nur der Reiche daran denken, dem Armen abzugeben von seinem Überfluss, es muss auch der Arme bedenken, dass der Reiche nicht glücklich in seinem Glanze und Besitze lebt, und wenn beide das gesehen haben, haben beide ein Stückchen von Allahs Mantel erfasst. So können wir alle in Frieden in dieser Welt leben, die voll Wunder und Schrecken ist.
Das alles sprach Sindbad der Seefahrer. Da verneigte sich Sindbad der Lastträger vor ihm und bedankte sich. Sie wurden Freunde für`s Leben und trafen sich noch oft in dem schönen Haus mit den schönen Gärten.
Dies alles erzählte Scheherazade. Wieder war ein Tag vergangen und der Morgen graute. Da sprach der König: Die Geschichte von Sindbad dem Seefahrer war wirklich beeindruckend. Doch ich glaube nicht, dass er durch Einsicht zu so einer Bescheidenheit gelangte.
Es ist leicht, bescheiden zu werden, wenn man alles gehabt hat, wenn man Geld und Schätze besaß und wenn man die Welt bereist hat. Was aber ist, wenn man zu Hause blieb und die Welt nicht kennen lernte.
Da lächelte Scheherazade und sprach: Erhabener König, es ist nicht immer nötig, weit über das Meer zu fahren. Einsicht erlangen können wir überall. Hier im Haus genauso wie im Land der Drachen oder auch auf dem Markt dort drüben.
Der König war immer noch beeindruckt von ihrer Geschichte. War sie auch wirklich wahr?, wollte er wissen. Man sagt, sie ist wahr, erwiderte Scheherazade. Die Welt ist voller Wunder, und so sind viele Geschichten der Reisenden voller Kostbarkeiten.
Doch im Grunde sind sogar die Märchen wahr. Es ist nicht wichtig, ob es Zwerge oder Riesen gibt, wichtig ist, welche Wahrheit sie uns mit ihrer Geschichte erzählen wollen. Egal, ob sie sich auf fernen Inseln im Ozean zutragen oder in der nächsten Umgebung im Wald. Sie sind Schätze der Weisheit, früher und heute.
Ich kenne eine Geschichte von Ali Baba, der war kein Weltreisender, sondern Holzfäller. Dazu war er ein Träumer. Trotzdem fand er Schätze, die aus Gold und auch aus Weisheit bestanden. Ich sehe schon, dass du eine neue Geschichte weißt, sagte der König. Aber pass bloß auf, dass sie mich nicht langweilt. Dann ging er hinaus.
Als er am nächsten Abend wieder kam, fragte er: Wie war das mit dem Holzfäller und den Schätzen.
Und Scheherazade erzählte.
