Vom tapferen Schneiderlein
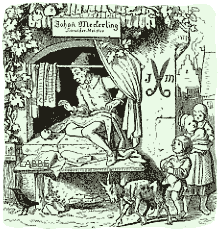
Es war einmal ein Schneider, der lebte in einem Städtchen mit dem Namen Romadia. Wenn der Schneider arbeitete, hatte er stets einen Apfel neben sich liegen. Und wie es in Sommerszeiten gewöhnlich so ist, setzten sich viele Fliegen darauf, waren sie doch von dem süßen Geruch des Apfels betört. Das aber erzürnte den Schneider gar sehr. Er nahm einen alten Tuchlappen, schlug auf den Apfel, und befand beim nächsten Hinsehen, dass nicht weniger als sieben Fliegen erschlagen waren.
"Ei", dachte sich das Schneiderlein, "du bist ein wahrer Held!" Da ließ er sich einen goldnen Harnisch machen, und auf dem Brustschild stand in goldnen Buchstaben geschrieben: "Sieben auf einen Streich."

Dann zog der Schneider auf Gassen und Straßen umher und ward mit seinem Harnisch sehr prächtig angetan. Und alle Leute glaubten fürwahr, der Held habe sieben Männer auf einen Streich gefällt. Da war dem faulen Schneiderlein plötzlich klar, wie er sein mühsames Handwerk endlich an den Nagel hängen konnte.
Nun war in demselben Lande ein König, dessen Lob weit und breit erschallte. Zu dem wollte der faule Schneider sich begeben. Kaum war er da, trat er in den Hof des Königspalastes und legte sich zum Schlafen hin. Die Hofdiener gingen fleißig ein und aus, bis sie den Schneider in seinem prächtigen Harnisch fanden. Er schien ohne Zweifel ein großer Herr zu sein, was sie aus der Goldschrift lasen. Doch dann fragte einer zögerlich, was dieser streitbare Mann in Friedenszeiten an des Königs Hof tun wolle?
Auch die Räte des Königs hatten den schlafenden Schneider gesehen. Sie ließen ihre allergnädigste Majestät wissen, dass im Falle eines Krieges der Held dem Lande recht nützlich sein werde. Dem König gefiel diese Rede wohl, und er sandte alsbald nach dem tapferen Recken. Dann fragte der König rund heraus: "Willst du in meine Dienste treten?" "Darum bin gekommen", antwortete der Schneider. Da nahm der König ihn in seine Dienste, verordnete ihm ein stattliches Gemach und obendrein noch einen fürstlichen Sold, von dem es sich herrlich und in Freuden leben ließ.
Es dauerte aber nur eine kurze Zeit, da waren des Königs Ritter dem Schneider übel gesonnen. Denn ihre bescheidene Löhnung war nur ein karger Tropfen im Vergleich zu dem, was der Held so alles bekam. Die Ritter wünschten den Helden also beim Teufel. Aber sie fürchteten sich auch allzumal, mochte der Held doch harten Widerstand leisten. Hätte er nicht gleich sieben auf einen Streich totgeschlagen, hätten sie ihn schon längst beim Kragen gepackt und hinausgeworfen.
Doch so sannen sie täglich und stündlich darauf, wie sie den wackeren Kriegsmann ausstechen könnten. Da ihr Scharfsinn aber etwas kurz geschnitten war, so wie ihre Röcklein, fanden sie nicht die rechte List, den Helden vom Hofe zu jagen. Da hielten sie wieder Rat miteinander und kamen überein, vor den König zu treten. Alle sollten um Freistellung und Entlassung bitten, was sie dann auch taten.
Als der gute König sah, dass seine treuen Ritter ihn um eines einzigen Mannes willen verlassen wollten, ward er so traurig wie nie zuvor. Er wünschte sich, der Held möge sich in Luft auflösen. Doch der König scheute sich, ihn wegzuschicken, musste er doch fürchten, dass der geharnischte Held den König samt all seinem Volke erschlagen würde.
Da der König nun klugen Rat in dieser schweren Sache suchte, ersann er letztlich eine List, womit er sich des Kriegsmannes zu entledigen gedachte. Er sandte sogleich nach dem Helden und lobte ihn, dass auf Erden kein gewaltigerer und stärkerer Kampfheld zu finden sei. Doch im nahen Walde gebe es da zwei gefährliche Riesen, die großen Schaden durch Rauben, Morden, Sengen und Brennen im Lande verübten. Man könne ihnen weder mit Waffen noch sonst wie beikommen, denn sie erschlügen alles, was sich ihnen nähere. Wenn er aber diese Riesen zur Strecke bringe, so solle er die Königstochter zur Gemahlin erhalten, und das halbe Königreich dazu. Auch wollte der König noch hundert Reiter geben, die ihm im Kampfe mit den Riesen zur Seite stehen sollten.
Auf diese Rede des Königs ward dem Schneiderlein ganz wohl zu Mute. Er dachte schon, dass des Königs Tochter und ein halbes Königreich ihm zu Füßen läge. Also sprach er keck, er wolle gern dem allergnädigsten König zu Diensten stehen. Und die Riesen könne er auch ohne Hilfe der hundert Reiter zu Tode bringen.
Darauf machte er sich in den Wald auf. Die hundert Reiter, die ihm auf des Königs Befehl folgen mussten, ließ er aber vor dem Walde warten. Der Schneider trat in das Dickicht und lugte lange umher, ob er die Riesen wohl sehen möchte. Da endlich, nach langer Suche fand er sie beide unter einem Baume tief und fest schlafend. Und die Riesen schnarchten so hart, dass die Äste an den Bäumen wie bei einem Sturmwind hin und her rauschten.
Das Schneiderlein besann sich nicht lange, las schnell eine Hand voll Steine auf und stieg auf den Baum, darunter die Riesen lagen. Dann warf er dem Ersten einen derben Stein auf die Brust, davon der Riese alsbald erwachte. Der Riese stieß zornig seinen Mitgesellen an und fragte, warum er ihn denn schlüge? Der andere Riese entschuldigte sich, so gut er es vermochte. Er habe es nicht mit Wissen getan, so sei es denn im Schlafe geschehen.
Da die Riesen nun wieder entschliefen, nahm der Schneider wieder einen Stein, und warf ihn jetzt dem Anderen an den Kopf. Der fuhr auf, erzürnte sich über seinen Kameraden und fragte, warum er ihn bewerfe? Der Gescholtene wollte aber nun auch nichts davon wissen.

Als beiden Riesen nach einigem Zank in Schlaf gefallen waren, warf der Schneider abermals gar heftig auf den ersten Riesen. Der mochte es nun nicht länger ertragen und schlug heftig auf seinen Nachbargesellen ein, von dem er sich geschlagen vermeinte. Das wollte denn der andere Riese auch nicht leiden. Beide sprangen auf und rissen kampfestoll die Bäume aus der Erde. Doch zu allem Glück verschonten sie den Baum, darauf der Schneider saß. Die Riesen aber schlugen mit den Bäumen so heftig aufeinander los, dass sie am Ende beide tot am Boden lagen.
Als der Schneider nun von seinem Baume sah, dass kein Lebensfunke in den Riesen mehr glühte, da stieg er fröhlich vom Baume herab. Mit seinem Schwerte brachte er den Riesen noch so manche Wunde bei, damit kein Zweifel die Heldentat befleckte. Dann trat der Schneider aus dem Walde hervor und stellte sich vor die hundert Reiter des Königs. Erstaunt fragten sie ihn, ob er die Riesen nirgends gesehen habe? "Ja", sagte der Schneider, "ich habe sie entdeckt und gesehen, und gleich alle zwei tot geschlagen. Das tat ich, und sie liegen jetzt leblos unter einem Baume."
Das war den Reitern verwunderlich zu hören. Sie konnten und wollten es nicht glauben, dass der eine Mann so unverletzt aus dem tödlichen Kampfe mit den Riesen hervorgegangen war. Die Reiter zogen nun selbst in den Wald, das seltsame Wunder zu ergründen. Doch sie fanden es so, wie der Held gesagt hatte. Da fuhr den Reitern ein grauslicher Schrecken in die Glieder, und es ward ihnen noch übler zu Mute denn zuvor. Schon fürchteten sie, der Unbezwingbare werde alle hundert umbringen, wenn er ihnen feindlich gesonnen sei. Geschwind ritten sie heim und sagten dem König an, was geschehen war.
Wenig später kam auch der Schneider zum König, um seinen Lohn zu empfangen. Er forderte nun die Königstochter samt dem halben Königreich. Da reute den König sein Versprechen, welches er so leichtfertig dem Kriegsmanne gegeben hatte. Nicht im mindesten war er gesonnen, seine Tochter dem Helden zu geben. Also dachte der König lange nach: Die Riesen waren ja nun zur Hölle gefahren und konnten keinen Schaden mehr tun. Brauchte es nur noch eine weitere List, sich des Helden zu entledigen.
Der König sprach zum Schneider, dass er in einem anderen Walde noch ein Einhorn habe. Dieses tue ihm sehr großen Schaden an Fischen und Leuten. Wenn er es vollbringe, auch noch dieses Einhorn zu fangen, dann wolle er, der König, ihm endgültig die Tochter geben. Der gute Schneider war damit zufrieden, nahm einen Strick und machte sich auf zu dem dunklen Orte, wo das wilde Einhorn hauste. Seinen Begleitern empfahl er wieder, draußen vor dem Walde zu warten. Er wolle hineingehen und ohne Hilfe allein die Tat bestehen, wie er es bei den Riesen auch schon gemacht habe.
Als der Schneider eine Weile im Walde umhergelaufen war, sah er plötzlich das Einhorn kommen. Mit vorgestrecktem Horn rannte es auf ihn ein, und wollte ihn von vorn bis hinten durchbohren. Doch der Schneider wartete nur, bis das Einhorn nahe genug heran war. Da schlüpfte der Schneider flink hinter den Baum, vor dem er so kühn gewartet hatte. Das Einhorn aber ward im vollen Galopp und konnte sich nicht mehr wenden. So stieß es mit aller Kraft gegen den Baum und versenkte sein spitzes Horn tief in die Rinde. Der Schneider sah das Einhorn am Baume zappeln und trat froh gelaunt hervor. Schnell schlang er dem Tier den Strick um den Hals und band es am Baume vollends fest.
Jetzt konnte das Schneiderlein in aller Ruhe zu seinen Jagdgesellen gehen, und ihnen den heldenhaften Sieg über das wilde Einhorn verkünden. Kurz darauf ging das Schneiderlein wieder zum König, und zeigte ihm die glückliche Erfüllung des königlichen Wunsches an. Und ganz nebenbei erinnerte der Schneider auch an das königliche Versprechen, das ja schon zum zweiten Mal ausgesprochen ward.
Der König zeigte sich über die Maßen betrübt. Was war zu tun, wo der Schneider doch seine Tochter begehrte, sie aber gar nicht haben sollte? Der König überlegte wieder lange, und forderte noch ein letztes Mal vom wackeren Kriegsmann, einen königlichen Wunsch zu erfüllen. Der Schneider sollte das grausame Wildschwein erlegen, das in einem dritten Walde hauste und alles verwüste. Wenn er auch dieses vollbrachte, dann wollte der König ihm die Tochter ohne Verzug in Gnaden geben.
Der Schneider war nicht sonderlich erbaut von des Königs abermaligem Begehren. Doch zog er schließlich mit der königlichen Jägerei aus. Als der Wald erreicht war, befahl er wieder seinen Begleitern, draußen zu warten. Die Jäger waren darüber herzlich froh, hatte das Wildschwein sie doch schon öfter böse zugerichtet. Keiner von ihnen war darauf aus, diesem ungeheuerlichen Tiere nachzustellen. Daher dankten sie dem Schneider, dass er sich allein in die Gefahr wage und sie sicher hinter sich lasse.

Der Schneider war noch nicht lange in den Wald getreten, so wurde das Wildschwein seiner ansichtig. Mit schäumendem Rachen und wetzenden Hauern stürmte es hervor, und wollte ihn gleich zu Boden rennen. Da bekam es auch der Schneider mit der Angst zu tun und sah sich schnell nach Rettung um. Zum Glück stand eine alte Kapelle in dem Walde. Da der Schneider von dem Gemäuer aber nur einen Katzensprung weit weg war, sprang er geschwind hinein. Doch auch das Schwein sprang mit einem großen Satz durchs Fenster, darin keine Scheiben mehr waren. Flink rannte der Schneider zur Türe hinaus, worauf ihm das Schwein zu folgen suchte. Der Schneider aber lief eilends um das Häuslein herum und warf noch rechtzeitig die Türe zu. So ward das grausame Wild im Kirchlein gut verwahrt und büßte seine Sünden.

Der Schneider ging nun zu den Jagdgesellen und erzählte ihnen von seiner Tat. Die Jäger kamen auch zum Kirchlein hin und befanden alles für richtig und wahr. Dann ritten sie zum König und brachten ihm die frohe Kunde. Dem König aber blieb jetzt nur noch eines: Er musste dem Helden die Hand seiner Tochter geben oder fürchten, dass dieser seine Heldenkraft gegen den König selbst wendet. Hätte der König aber gewusst, dass der Held nur ein armer Schneider war, dann hätte er ihn wohl lieber an einen Strick aufhängen lassen, statt ihm seine Tochter zu schenken.
Dem Schneiderlein konnte es egal sein. Also wurde Hochzeit gehalten, wenn auch nicht mit allzu großer Freudigkeit von königlicher Seite. Und aus einem Schneider ward ein Edelmann und König geworden.
Als eine kleine Zeit vergangen war, hörte die junge Königin, wie ihr Herr Gemahl im Schlafe redete. Sie vernahm deutlich die Worte: "Knecht, mache mir das Wams. Flicke mir die Hosen. Spute dich, oder ich schlage dir das Ellenmaß über die Ohren!" Das kam der jungen Königsgemahlin sehr verwunderlich vor. Sie merkte, dass ihr Gemahl von Haus aus ein Schneider war. Das zeigte sie ihrem Vater an und bat ihn, er möge sie doch von diesem Manne befreien. Solche Rede zerriss dem König fast das Herz. Wie konnte er nur seine einzige Tochter einem Schneider anvertrauen.
Der König tröstete seine Tochter aufs Beste und sagte, sie solle in der kommenden Nacht nur die Schlafkammer öffnen. Vor der Türe sollten aber etliche Diener stehen. Und wenn die Diener wieder solche Worte aus des Schneiders Mund vernähmen, sollten sie hineingehen und den Mann zu Tode bringen. Das ließ sich die junge Frau gefallen und verhieß alles so zu tun.
Nun hatte der König aber einen Waffenträger am Hofe. Der war dem Schneider wohl gesonnen. Der Waffenträger hatte des Königs untreue Rede gehört, machte sich daher eilends zu dem jungen König auf und hinterbrachte ihm das schwere Urteil, das soeben über ihn ergangen war. Dann bat der Waffenträger den Schneider, er möge sich seines Leibes nach besten Kräften wehren. Der Schneider-König sagte Dank und unterbreitete dem Waffenträger, dass er wohl wisse, was in dieser Sache zu tun sei.
Wie nun die Nacht gekommen war, begab sich der junge König zu gewohnter Zeit mit seiner Gemahlin zu Bette. Schon bald tat er so, als ob er schliefe. Da stand die Frau heimlich auf und öffnete die Tür, worauf sie sich wieder niederlegte. Nach einer Weile begann der junge König wie im Schlafe zu reden, aber mit klarer Stimme, sodass es draußen vor der Kammer wohl zu hören war: "Knecht, mache mir die Hosen. Richte mir das Wams, oder ich will dir das Ellenmaß über die Ohren schlagen. Ich hab sieben auf einen Streich tot geschlagen. Zwei Riesen hab ich tot geschlagen. Das Einhorn hab ich gefangen. Die Wildsau hab ich auch noch gefangen. - Sollt´ ich da das Gesinde fürchten, das draußen vor der Kammer so zahlreich steht?"

Als die Diener solche Worte vernahmen, flohen sie wie von tausend Teufeln gejagt in alle Richtungen auseinander. Keiner wollte derjenige sein, der sich an den Schneider wagte. Und so war und so blieb das tapfere Schneiderlein ein König bis an sein Lebensende.
